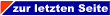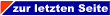
Herr Präsident Professor Vilmar! Herr Ministerpräsident Dr. Stolpe! Herr Oberbürgermeister Kleinschmidt! Herr Dr. Wolter! Meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen für die Einladung – meine erste Einladung – zum Ärztetag. Ich weiß, daß die Gesundheitsreform eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema dieses Ärztetages sein wird, und ich bin froh über die Gelegenheit, Ihnen hier heute meine Vorstellungen dazu darlegen zu können.
Herr Professor Vilmar hat es gerade schon angesprochen: Nach dem heftigen Schlagabtausch der letzten Wochen erwarten vermutlich einige jetzt so etwas wie einen "Showdown" zwischen den Beteiligten. Ich bin ausdrücklich unbewaffnet hierhergekommen, und ich möchte auch auf jeden weiteren Akt in diesem Drama, das sich die letzten Tage entwickelt hat, verzichten. Mein Interesse ist, daß wir wieder in Ruhe miteinander sprechen können. Deswegen möchte ich hier mit einigen Klarstellungen dazu beitragen, daß wir hoffentlich einen "Abrüstungsprozeß" einleiten können.
Der eine Punkt ist, daß die Kassenärztliche Bundesvereinigung sich entschieden hat, mit einer Vielzahl von publizistischen Mitteln Front gegen die Gesundheitsreform zu machen. Ich meine, daß ich – davon ist die Meinungsfreiheit völlig unberührt – zu Recht einige kritische Anfragen an dieses Vorgehen stelle, da die Kassenärztliche Bundesvereinigung als Körperschaft des öffentlichen Rechts andere Aufgaben als eine Gewerkschaft wahrnimmt. Ich habe deswegen die Kassenärztliche Bundesvereinigung für nächste Woche zu einem Austausch der Positionen eingeladen, und ich hoffe sehr, daß wir dort zu einer Verständigung kommen, so daß dieser Konflikt beigelegt werden kann und nicht weiter eskaliert.
Ich denke, wir sind uns einig, daß es um das Wohl von Patientinnen und Patienten geht. Dann möchte ich aber auch darauf beharren, daß die Patienten nicht in eine Auseinandersetzung zwischen der organisierten Ärzteschaft und der Bundesregierung hineingezogen werden dürfen.
(Vereinzelt Beifall)
Ich sehe hier die Grenze zwischen Aufklärung und Verunsicherung überschritten und möchte Sie deswegen bitten, Form und Inhalt Ihrer Materialien noch einmal zu überprüfen.
(Zuruf: Und vice versa!)
Der zweite Punkt ist, daß es im Zuge der Diskussionen in den letzten Tagen auch eine sehr scharfe Kontroverse um die Arzneimittelausgaben gegeben hat. Ich gebe zu, daß ich meinen Teil zur Schärfe dieser Auseinandersetzung beigetragen habe. Ich bedaure ausdrücklich, daß dabei der Eindruck entstanden ist, ich wollte die Ärzteschaft eines unethischen Verhaltens bezichtigen. Dies war nicht meine Absicht.
(Vereinzelt Beifall)
Es ist unbestritten, daß die Mehrwertsteuererhöhung, die Zuzahlungsrückführung und die Grippewelle Ursachen für den Ausgabenanstieg sind. Hier ist sicherlich nicht der Ort für eine Klärung der Differenzen, die wir bezüglich der Größenordnung des jeweiligen Effekts haben. Ich würde gerne deutlich machen, woran sich meine Kritik entzündet hat.
Von seiten der Vertreter der Ärzteschaft wurde die Ausgabenentwicklung des ersten Quartals hochgerechnet und die Erschöpfung der Budgets prognostiziert und an die Wand gemalt. Aber gerade wenn man sagt, daß die Gesundheitssituation im Winter die Hauptursache für die Ausgabensteigerung war, dann muß es jetzt zu einer Trendwende kommen. Darüber hinaus sind die Kassenärztlichen Vereinigungen in der Pflicht, das Verordnungsverhalten durch Information und Beratung positiv zu beeinflussen. Das erwarte ich von allen Beteiligten.
Ich hoffe, daß diese Ausführungen dazu beitragen konnten, wieder eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu finden, und möchte darauf hinweisen, daß Abrüstung nur als zweiseitiger Prozeß gelingt.
Ich würde jetzt gerne in einigen Punkten unser Reformkonzept darstellen, soweit es in dem hier gebotenen Zeitraum möglich ist.
Herr Dr. Schorre hat unser Projekt als ein "umstürzlerisches" Vorhaben bezeichnet. Ich glaube, Herr Dr. Schorre, damit tun Sie unserer Reform zuviel Ehre an. Sie ist doch wesentlich näher an den Realitäten, und sie wird das Gesundheitswesen nicht auf den Kopf stellen. Ich hoffe sehr, daß im Laufe der Diskussionen, die wir in diesem Jahr darüber noch zu führen haben, der Teil derjenigen größer wird, die unsere Vorschläge als das sehen, als was sie gemeint sind: als ein Angebot, unser Gesundheitswesen im Sinne von Patientinnen und Patienten zu verbessern und damit auch die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten zu erleichtern.
(Widerspruch)
Wir haben heute ein Gesundheitswesen, das besser ist als in vielen anderen Ländern, und das wollen wir auch in Zukunft haben. Es stellt die notwendigen Leistungen für alle, unabhängig vom Einkommen, bereit, es baut auf die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Jungen und Alten, gut und schlechter Verdienenden, Singles und Familien und gibt dem einzelnen Sicherheit im Krankheitsfall. Ich will dieses System bewahren und es für die Zukunft fit machen. Dafür braucht es ständige Veränderungen, weil sich auch die äußeren Bedingungen ändern. Deswegen brauchen wir eine Reform, weil wir nur mit Veränderungen die Zukunft für ein so komplexes System wie unser Gesundheitswesen sichern können.
Ich gehe davon aus, daß wir dabei vor allen Dingen vor drei Herausforderungen stehen, denen die Politik gerecht werden ist. Die erste ist der demographische Wandel, der dazu führt, daß wir eine Zunahme von chronisch kranken Menschen und mehrfach erkrankten Menschen haben. Der zweite Punkt ist der medizinische Fortschritt. Neue Behandlungsmöglichkeiten, Diagnosetechniken und Medikamente erweitern das Angebot im Gesundheitswesen. Der dritte Punkt ist eine veränderte Haltung der Menschen gegenüber allen sozialen Sicherungssystemen und damit natürlich auch gegenüber dem Gesundheitswesen. Sie treten solchen Systemen und den darin Handelnden kritischer und selbstbewußter gegenüber. Sie wollen nicht länger Objekte sein, sondern Subjekte und selber mitentscheiden.
Was diese Herausforderungen anbelangt, könnten wir hier wahrscheinlich mit vielen Einigkeit erzielen. Einer der kontroversen Punkte ist, ob die Antwort auf diese Herausforderungen sein muß, daß wir immer mehr Geld ins Gesundheitssystem geben. Meine Anwort – daran entzündet sich ja Ihre Kritik – ist, daß wir statt dessen Strukturverbesserungen brauchen. Wir brauchen mehr Kooperation zwischen allen Beteiligten im Gesundheitswesen, wir müssen die Qualität der medizinischen Versorgung in den Mittelpunkt stellen und die Patientinnen und Patienten stärken. Ich bin davon überzeugt, daß auch Ärztinnen und Ärzte von einer Reform, die sich diesen Herausforderungen stellt, profitieren können. Das würde ich Ihnen gerne im folgenden darlegen.
Sie wissen besser als ich, daß die Situation in der Ärzteschaft immer noch sehr stark vom Einzelkämpfertum geprägt ist, daß die Einzelpraxen noch dominieren, daß es zuwenig Verzahnung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich gibt. Das führt nicht nur zu überflüssigen Doppeluntersuchungen und Mehrfachuntersuchungen der Patientinnen und Patienten, sondern das führt auch zu einer unbefriedigenden Arbeitssituation für Ärztinnen und Ärzte.
(Widerspruch)
Wir haben deswegen – das ist gar nichts Neues, sondern eher ein Klassiker in der gesundheitspolitischen Diskussion – als ein wichtiges Moment dieser Gesundheitsreform die Verzahnung in den Vordergrund gestellt. Wir haben in den letzten Jahren über Modellversuche reichlich Erfahrungen mit integrierten Versorgungsformen gesammelt. Wir wollen daraus Schlußfolgerungen ziehen und sie zu einem Teil der Regelversorgung machen, so daß Patienten auch solche Versorgungsformen auswählen können. Die Initiative für ganz viele von diesen Modellversuchen ist zumeist von Ärztinnen und Ärzten ausgegangen, die nicht mehr isoliert arbeiten, sondern mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten wollten und sich deswegen bewußt für diese neuen Kooperationsformen entschieden haben.
Wir wollen den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen auch bei der integrierten Versorgung erhalten. Wir haben in der letzten Zeit viel darüber diskutiert, auch mit der KBV und der Bundesärztekammer. Daraus ist der Vorschlag entstanden – den Sie im Referentenentwurf nachlesen können -, daß es auf Bundesebene eine Rahmenvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen geben soll. Es wird ein Katalog aufgestellt, der die Kriterien festlegt: Was ist eigentlich ein integriertes Versorgungsmodell? Welche Mindestbedingungen muß es erfüllen? Was sind die Qualitätsstandards? Wie soll die Zusammenarbeit genau ausschauen?
Wir greifen mit den Vorschlägen, die wir im Entwurf gemacht haben, auch eine Kritik aus den letzten Jahren auf, wo solche Modellversuche manches Mal vor Ort, auch auf Grund von innerärztlicher Konkurrenz, nicht zustande gekommen sind. Wir sind uns – das ist auch in den Positionspapieren der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nachzulesen – einig, daß das bisherige Vetorecht der KVen zugunsten einer Schiedsamtslösung aufgegeben werden soll. Es ist vorgesehen, daß auch die Kassenärztlichen Vereinigungen Vertragspartner werden können. Die Behauptung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, daß die Kassen Verträge mit einzelnen Ärzten schließen können, trifft nicht zu; das steht so nicht im Gesetzentwurf.
(Zurufe)
Die Situation der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist – das wissen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung – auch von einem massiven Verteilungskampf geprägt. Das Bild vom Hamsterrad wegen der ständigen Mengenausweitung und dem damit einhergehenden Punktwertverfall stammt nicht von mir. Wir wollen diesen Kreislauf durchbrechen, und zwar unter anderem durch folgende Vorschläge: durch die Trennung der Gesamtvergütung in einen Hausarzt- und einen Facharzttopf, durch eine weitere Abkehrung von der Einzelleistung hin zu Komplexgebühren und durch die Einführung von Leitlinien in der Therapie.
Auch in bezug auf die Wirtschaftlichkeit soll künftig die Qualität ins Zentrum gerückt werden. Statt sich wie bisher am statistischen Durchschnitt auszurichten, wobei die Besonderheiten einzelner Praxen unberücksichtigt blieben, sollen künftig Indikationsstellung, Effektivität und Effizienz der Behandlung entscheidend sein. Alle diese Maßnahmen haben eine patientengerechtere Behandlung zum Ziel, und sie sollen dazu beitragen, die Arbeitssituation von Ärztinnen und Ärzten zu verbessern.
(Lachen – Vereinzelt Beifall)
Wir
wissen – davon war auch schon im Eingangsbeitrag von Herrn
Dr. Wolter die Rede –, daß die Situation der
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Ostdeutschland sehr
schwierig ist. Das Tempo des Einigungsprozesses und die
besonderen Bedingungen bei der Niederlassung haben für einzelne
zu einer prekären Situation geführt. Um so mehr möchte ich das
große Verdienst der Ärzteschaft herausstellen, daß es für den
niedergelassenen Bereich gelungen ist, die gesamtdeutsche
Grundlohnrate zur Grundlage für die Ausgabenentwicklung zu
nehmen. Ich betrachte das als einen Akt echter Solidarität unter
Kollegen. Ich denke, das sollte nicht – wie ich es schon
manchmal gehört
habe –
als Almosen bezeichnet werden.
Es war eben schon von der Sorge die Rede, daß eine schlechte Grundlohnentwicklung in Ostdeutschland in einer Art Teufelskreis zu einer immer schlechteren Ausgabenentwicklung führen könnte. Genau das soll nicht passieren. Deswegen sollen sich die Ausgaben in den nächsten Jahren am gesamtdeutschen Lohndurchschnitt orientiert entwickeln, so daß die neuen Länder nicht weiter abdriften. In dem – von uns allen durchaus auch erwünschten – Fall, daß die Einkommen in Ostdeutschland stärker steigen als im Westen, soll zugunsten des Ostens davon abgewichen werden.
Herr Ministerpräsident Dr. Stolpe hat vorhin schon davon gesprochen, und auch ich halte es für außerordentlich bedeutsam, daß wir den Risikostrukturausgleich entfristet und damit allen Tendenzen entgegengewirkt haben, mit einer Regionalisierung von Sozialversicherungsbeiträgen denen entgegenzukommen, die meinen, es gehe ihnen jetzt gut und sie könnten den Osten alleine lassen. Wir haben uns mit der Entfristung des Risikostrukturausgleiches und der Abschaffung der Deckelung ab dem nächsten Jahr ausdrücklich zu einer gesamtdeutschen Solidarität bekannt. Ich halte das für ein ganz entscheidendes Instrument, dazu beizutragen, daß die ostdeutschen Verhältnisse sich auch im Gesundheitswesen in einer überschaubaren Perspektive an die westdeutschen angleichen.
Was die Situation in 1999, die auch von Herrn Dr. Wolter angesprochen wurde, anbelangt, so sind wir zur Zeit im Gespräch mit allen Beteiligten, um zu sehen, ob wir in diesem Jahr eine Sonderregelung treffen müssen. Es wird sich sicherlich in den nächsten Wochen weisen, was dort zu geschehen hat.
Wir haben einen weiteren Punkt, der auch unter das Stichwort Kooperation fällt, nämlich die Verzahnung des ambulanten und des stationären Bereichs. Dies wird auch schon sehr lange gefordert. Trotzdem herrscht durchaus Besorgnis, daß man, wenn man dieser Forderung nachkommt, die Türen so weit öffnet, daß es nicht nur einen Luftzug gibt, sondern richtig Durchzug, der einen umpusten könnte. Diese Ängste haben wir bei der Formulierung der Veränderungen zwischen den beiden Bereichen sehr ernst genommen. Daraus folgt, daß wir einerseits den Katalog der ambulanten Leistungen erweitern wollen. Wir wollen ihn auf den neuesten Stand bringen. Neben Operationen sollen auch andere Eingriffe aufgenommen werden. Es soll klar festgelegt werden, wo die ambulante Behandlung der Regelfall ist und die stationäre Behandlung die Ausnahme.
Im Gegenzug wollen wir neue Kategorien von Möglichkeiten ambulanter Behandlung im Krankenhaus schaffen. Dazu soll ein dreiseitiger Vertrag zwischen den KVen, den Kassen und den Krankenhäusern geschlossen werden. Es geht dabei um einen Katalog komplizierter Krankheitsverläufe und hochspezialisierter Leistungen, die eine solche Behandlung rechtfertigen, zum Beispiel im Bereich der Onkologie und bei Aids.
Außerdem möchten wir, daß es über die Notaufnahme nicht zu unnötigen stationären Aufnahmen kommt. Deswegen schlagen wir vor, daß Krankenhäuser mit Notfallambulanzen mit den KVen eine Zusammenarbeit vereinbaren, die die Vertragsärzte mit einbezieht.
Uns wird vorgeworfen, dies sei eine Überreglementierung, es sei Listenmedizin und wie es sonst noch heißt. Ja, ich bekenne mich dazu: Das ist reglementierend. Aber die Alternative hieße, daß wir die trennenden Mauern zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich einfach einreißen, ohne dafür zu sorgen, daß dies auf eine für alle Beteiligten verträgliche Art und Weise geschieht. Wenn man einen Weg sucht, daß die Menschen, die dort arbeiten, nicht die Angst haben müssen, sie würden in einen ominösen Konkurrenzkampf getrieben, werden die Regelungen komplizierter, aber damit vielleicht auch für alle akzeptabel.
Besonders viel Aufmerksamkeit hat in der Öffentlichkeit unser Ziel gefunden, die hausärztliche Versorgung zu stärken. Angesichts der Komplexität des Gesundheitswesens macht es Sinn, daß Patientinnen und Patienten einen Arzt oder eine Ärztin ihres Vertrauens an ihrer Seite haben, die dafür sorgen, daß sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort behandelt werden. Ich denke, daß ein solches Vertrauensverhältnis gerade für Menschen mit komplizierten Krankheitsverläufen wichtig ist.
Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um ein Mißverständnis auszuräumen, das mir sehr häufig begegnet, nämlich daß Chroniker, die einen Arzt ihres Vertrauens gefunden haben, der aber nicht Hausarzt ist, diesen aufgeben müßten. Das ist ausdrücklich nicht gewollt. Es geht darum, daß jeder Mensch einen Arzt oder eine Ärztin seines Vertrauens für seine Krankheit findet. Für viele Menschen kann und wird der Hausarzt diese Funktion übernehmen, aber es muß kein Hausarzt sein. Ich sage es noch einmal ganz ausdrücklich: Die freie Arztwahl bleibt unangetastet, denn sie ist eine ganz zentrale Voraussetzung für das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten.
Die Stärkung der Funktion des Hausarztes in unserem Gesundheitssystem ist ein Prozeß. Dazu wird es nur kommen, wenn wir die Menschen von der Richtigkeit und der Qualität dieser Art der Versorgung überzeugen. Ich möchte – dabei berufe ich mich durchaus auch auf positive Stellungnahmen von seiten der Fachärzteschaft, die dazu ermuntert, dieses nicht als einen Konkurrenzkampf zu betrachten, sondern als etwas, was im beiderseitigen Interesse ist –, daß es eine gut abgegrenzte Zusammenarbeit zwischen den Haus- und Allgemeinärzten einerseits und den Fachärzten andererseits gibt.
Ein weiterer Punkt, der von Bedeutung ist, weil allein ein Drittel aller Gesundheitsausgaben in diesen Bereich fließt, ist der Krankenhausbereich. Wir müssen ihn in eine Gesundheitsreform einbeziehen. Wir wollen den Grundsatz ambulant vor stationär weiter durchsetzen. Das bedeutet – dazu bekenne ich mich – auch einen Kapazitätsabbau in den Krankenhäusern. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig, daß wir einen entsprechenden bedarfsgerechten Aufbau in anderen Bereichen brauchen. Das bedeutet für viele Beschäftigte, daß sich daraus neue Tätigkeitsfelder ergeben, weil wir neue kooperative Formen der Versorgung brauchen.
Wir wollen aber auch innerhalb des Krankenhaussektors mehr Flexibilität in der Mittelverteilung ermöglichen und gleichzeitig mehr Kostentransparenz in den Kliniken schaffen. Immer noch wissen viele Kliniken selbst nicht, ob sie wirtschaftlich arbeiten und wo konkrete Verbesserungsmöglichkeiten liegen. Deshalb soll in den nächsten Jahren ein umfassendes Fallpauschalensystem eingeführt werden – das nach meiner Wahrnehmung nicht so umstritten ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint; man muß nur einmal genauer hinhören, was die verschiedenen Beteiligten dazu sagen. Ich denke, daß wir durch ein solches Fallpauschalensystem ein großes Maß an Transparenz für das gesamte Leistungsgeschehen im Krankenhaus erreichen können. Dort, wo man im Rahmen von Betriebsvergleichen zum Beispiel schon Preissysteme angewandt hat, hat sich oft gezeigt, daß kein zwingender Zusammenhang zwischen hohen Kosten und hoher medizinischer Qualität besteht. Man kann es auch andersherum sagen: Häuser mit vergleichsweise niedrigen Kosten können bessere Leistungen und gleichzeitig eine höhere Zufriedenheit sowohl bei Patienten als auch bei Mitarbeitern erreichen.
Das Fallpauschalensystem muß auch in der Lage sein, Investitionsanteile abzubilden. Damit wäre ich beim zweiten Punkt der Veränderungen im Krankenhausbereich: der monistischen Krankenhausfinanzierung, die in drei Stufen bis zum Jahr 2008 eingeführt werden soll. Ich will das hier nicht zu breit ausführen. Ich will nur eines sagen, von dem ich weiß, daß es besonders große Besorgnis hervorruft: Die Länder bleiben in die Rahmenplanung einbezogen. Kassen und Länder verständigen sich über das Wieviel an stationärer Versorgung. Sollten Kassen Verträge mit Häusern oder einzelnen Abteilungen kündigen wollen, so müssen sie sich an gemeinsam mit den Ländern gefundene Rahmenvorgaben halten, die auch am Ziel eines flächendeckenden Angebots orientiert sind. Die letzte Verantwortung liegt bei den Ländern. Deshalb – das möchte ich hier noch einmal betonen – kann man dies keinesfalls als ein Einkaufsmodell bezeichnen.
Auf Bundesebene setzt der Gesetzgeber durch solche Regelungen in erster Linie die finanziellen Rahmenbedingungen. Der Einfluß auf die konkrete Arbeit in den Krankenhäusern, die vor allen Dingen seitens der Beschäftigten Anlaß zu Kritik gibt, ist nur gering, das heißt, wir haben nur begrenzt Einfluß auf die hohe Arbeitsbelastung sowohl des Pflegepersonals als auch der Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern. Trotzdem wollen wir zumindest versuchen, Anreize und Chancen für Veränderungen für die Beschäftigen im Krankenhaus zu schaffen. Dabei verspreche ich mir viel von einer Verbesserung von Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Es geht dabei vor allen Dingen um eine Verpflichtung auf interne Qualitätssicherung, was sich innerhalb der Häuser auch durch eine andere Zusammenarbeit auswirken soll. Dazu kommt aber die Aufforderung, an einem externen Qualitätsvergleich teilzunehmen und voneinander zu lernen. Die Krankenkassen – auch das soll ein Anreiz sein – können es honorieren, wenn Einrichtungen Qualitätsmanagement durchführen. Es gibt durchaus positive Beispiele von Krankenhäusern, die auf diese Art und Weise hervorragende Ergebnisse erzielt haben, indem sie eben nicht nur Kosten reduzieren, sondern vor allen Dingen die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch die Zufriedenheit von Patientinnen und Patienten steigern konnten.
Ich möchte noch zu einem Bereich kommen, der besonders viel Aufmerksamkeit, gerade auch Ihrerseits, gefunden hat. Das ist die Frage der Selbstverwaltung und ihrer künftigen Rolle. Auch bei unserer Gesundheitsreform wird es bei
der starken Rolle der Selbstverwaltung bleiben, und ihr werden weitere Aufgaben übertragen.
(Lachen – Widerspruch)
Ich denke, daß die Selbstverwaltung nur dann weitere Aufgaben übernehmen kann, wenn ihre Strukturen entsprechend ausgestaltet sind. Ich greife hier die Debatte, die auch innerhalb der Selbstverwaltung geführt wird, über die Notwendigkeit einer Modernisierung der Strukturen auf. Es ist mit einer Struktur mit ehrenamtlichem Vorstand, hauptamtlicher Geschäftsführung und ehrenamtlicher Vertreterversammlung nicht immer ganz einfach, den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.
(Widerspruch)
Diese Diskussion haben wir aufgegriffen. Mit der Neuordnung der inneren Organisation sind hauptamtliche Vorstände vorgesehen, aber es ist ebenso vorgesehen, daß diesen auch weiterhin die Tätigkeit als Vertragsarzt ermöglicht wird.
(Widerspruch)
Es gibt – das ist ein weiterer Punkt, der mir dabei sehr wichtig ist – eine Vielzahl von verschiedenen Meinungen, auch innerhalb der Ärzteschaft. Die Repräsentanz der verschiedenen Meinungen in den Organen der Selbstverwaltung hängt auch vom angewandten Wahlrecht ab. Beim Mehrheitswahlrecht bleiben Minderheiteninteressen unterrepräsentiert. Deswegen meine ich, daß das Verhältniswahlrecht in allen KVen verbindlich eingeführt werden sollte, damit alle maßgeblichen Gruppen die Möglichkeit haben, Vertreter entsprechend ihrer Stärke in die Selbstverwaltungsorgane zu schicken. Wir haben auf allen Ebenen unseres Landes, auf denen wir demokratische Wahlen durchführen, das Verhältniswahlrecht. Es ist durchaus so, daß das Verhältniswahlrecht auch von vielen Ärztinnen und Ärzten schon lange gefordert wird.
Vieles von dem, was ich hier gerade ausgeführt habe, ist keine neue Erfindung. Es gibt darüber seit langem Debatten, und dementsprechend erachte ich es für sinnvoll, an diesen Punkten zu arbeiten. Ich denke, daß wir alle gemeinsam ein Interesse an der Verbesserung der medizinischen Versorgung haben müssen. Wenn man sich genau anschaut, was wir vorhaben, erweist sich, daß das in der Tat für viele eine Chance sein kann. Ich möchte Sie ausdrücklich bitten, dazu Verbesserungsvorschläge zu machen und nicht das Ganze in Bausch und Bogen zu verdammen.
Ich möchte abschließend zu dem von Ihnen nach meinem Kenntnisstand am allerschärfsten kritisierten Punkt kommen: die Frage des Globalbudgets. Ich bin der festen Überzeugung, daß wir die Beitragssatzstabilität als einen Parameter in der gesundheitspolitischen Diskussion anerkennen müssen. Kritik an den sozialen Sicherungssystemen seitens der Bevölkerung entzündet sich auch an steigenden Beiträgen. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, daß das gerechtfertigt ist, denn das Gesundheitswesen ist kein extraterritorialer Bereich außerhalb unserer Gesellschaft, sondern es ist Teil der Gesellschaft. Deswegen halte ich eine Ankoppelung an die Entwicklung unserer Gesellschaft in Form der Einkommensentwicklung für recht und billig.
(Widerspruch)
Falsch ist jedoch die immer wieder kolportierte Behauptung, wir würden damit die Mittel für das Gesundheitswesen reduzieren. Die Ausgaben werden entsprechend der Veränderungen der Grundlohnrate steigen. Wenn wir von einem durchschnittlichen Grundlohnanstieg von 2 Prozent pro Jahr ausgehen, dann bedeutet dies 5 Milliarden DM pro Jahr mehr im System. Unser Interesse ist, dieses Geld vernünftig und effizient auszugeben.
(Zurufe)
Das Mittel dafür ist das Globalbudget. Ausgehend von der Prämisse der Beitragssatzstabilität, heißt das nichts anderes – ich will Sie daran erinnern, daß das nicht erst ein Grundsatz der neuen Bundesregierung ist, sondern daß das schon seit vielen Jahren im Sozialgesetzbuch verankert ist –, als daß wir nicht mehr ausgeben können, als wir einnehmen. Dabei ist es wichtig, daß wir eine größere Flexibilität zwischen den Sektoren des Gesundheitswesens haben. Ich betone noch einmal ausdrücklich, daß die Verteilung der Mittel auf die Sektoren nicht von den Kassen allein entschieden werden kann. Es wird weiterhin die Aufgabe aller Partner in der Selbstverwaltung sein, die Kapazitäten der Versorgung in Verträgen auszuhandeln.
Der zentrale Vorwurf an das Globalbudget lautet, es würde eine Rationierung von Leistungen beinhalten. Rationierung hieße, daß den Menschen die medizinisch notwendigen Leistungen vorenthalten werden.
(Beifall)
Ich sage ausdrücklich, daß wir das verhindern wollen, indem wir allen Beteiligten Instrumente an die Hand geben, mit den vorhandenen Mitteln eine gute Versorgung zu gewährleisten, und ich bin ganz sicher, daß wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir auf Qualität und Kooperation setzen.
Was ist die Alternative zu diesem Weg, innerhalb des Systems zu schauen, wie wir die Leistungen gut und besser erbringen können? Sie können natürlich die Einnahmeseite verändern, Sie können die Zuzahlungen drastisch anheben und damit von den Patienten mehr Geld verlangen, oder Sie können, nach welchen Regeln auch immer, eine reduzierte Versorgung für alle und private Zusatzleistungen für wenige anstreben. Das, meine Damen und Herren, ist die Zweiklassenmedizin, die Sie uns immer vorwerfen und die wir genau verhindern wollen.
(Vereinzelt Beifall)
Ich bin der festen Überzeugung, daß mit den vorhandenen Mitteln eine qualitativ hochwertige Versorgung, die auch die Veränderungen, die ich eingangs skizziert habe, berücksichtigt, möglich ist. Die Voraussetzung dafür ist, daß wir ständig prüfen, was wir in unserem Gesundheitswesen machen und was wir besser machen können. Natürlich muß klar sein, daß die gesetzliche Krankenversicherung ein System ist, das eben nur das Notwendige und das Sinn- und Zweckmäßige beinhaltet, und nicht alles, was vielleicht wünschenswert wäre, möglich ist. Um dieses klarzumachen, tragen auch Instrumente wie die Arzneimittelrichtlinie, die wir rechtsfest machen werden, und die Positivliste, wie wir sie geplant haben, bei. Darüber müssen wir sicherlich auch in die Auseinandersetzung mit den Versicherten und mit den Patientinnen und Patienten eintreten. Ich werde mich dieser Aufgabe stellen, soweit ich das in meiner Rolle kann.
Aber Sie wissen doch auch, daß es ein Mythos ist, daß eine optimale Versorgung nur dann möglich ist, wenn die Mittel ständig steigen. Ich darf Herrn Dr. Schorre noch einmal anders zitieren als eingangs:
Das entscheidende Geschehen findet in der Beziehung zwischen Arzt und Patient statt. Dort müssen wir Ärzte den Mut haben, strikt nach Indikation und unter Wahrung hoher Qualitätsnormen medizinisch nicht unbedingt Notwendiges zu unterlassen, um das Wichtige erhalten zu können.
Genau darum geht es uns. Ich meine, daß wir alle ein Interesse haben müßten, diesen Prozeß zur Erhaltung dieses Systems mit seinem solidarischen Charakter immer wieder neu zu befördern.
Im Mittelpunkt der Reform, wie wir sie jetzt planen – wir haben nie behauptet, daß sie alle Fragen der Gesundheitspolitik abschließend löst –, stehen Strukturveränderungen. Das bedeutet nicht, daß wir nicht mittelfristig auch über Fragen des Organisationsrechts, der Erweiterung der Bemessungsgrundlage und anderes reden müssen.
Eine letzte Bemerkung zu der Forderung: mehr Geld ins System. Selbst wenn wir alle gemeinsam hier die eine Möglichkeit fänden, die Finanzmittel für das Gesundheitswesen noch stärker aufzustocken als nach unserem Vorschlag: Am Ende haben wir in diesem solidarischen System immer nur eine begrenzte Menge Geld zur Verfügung. Deswegen müssen wir stets die Frage beantworten, wie wir mit begrenzten Ressourcen sinnvoll umgehen, so daß die Versorgung gut ist, daß aber auch diejenigen, die in diesem Gesundheitswesen arbeiten, sich fair behandelt fühlen. Diese Frage wird für uns immer wieder auf der Tagesordnung stehen, selbst wenn wir, wie gesagt, an der Einnahmeseite noch heute etwas ändern würden. Deswegen plädiere ich an alle, sich nicht über die Begrenztheit der Mittel zu empören, sondern sich an der Suche danach zu beteiligen, wie man ein modernes und leistungsfähiges Gesundheitswesen gestalten kann.
Nun liegt ein Referentenentwurf auf dem Tisch. Die Diskussion darüber wird das ganze Jahr hindurch weitergehen. Wir werden dafür mit Anhörungen und anderen Formen Gelegenheiten schaffen. Ich weiß, daß sich der Ärztetag in den nächsten Tagen intensiv mit diesem Gesetz beschäftigen wird. Wir sind uns beim Ziel einer patientengerechten Gesundheitsreform einig, auch wenn wir sicherlich ganz viele Kontroversen über den Weg haben. Ich wünsche mir und uns allen – und ich werde meinen Teil dazu beitragen –, daß wir darüber eine Diskussion in der Sache führen und daß die Ergebnisses des Ärztetages Auswirkungen auf den weiteren Prozeß der Diskussion über das Gesetz haben werden. Gerade im Bewußtsein dessen, daß Ihre Beratungen über unseren Gesetzentwurf mit Sicherheit sehr kritisch sein werden, wünsche ich dem Ärztetag einen guten Verlauf.
(Beifall)