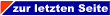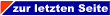
Frau Bundesministerin Fischer! Herr Ministerpräsident Stolpe! Herr Oberbürgermeister Kleinschmidt! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst danke ich Ihnen, lieber Herr Kollege Wolter, ganz herzlich für den Empfang, die Einladung hier nach Cottbus und die eindrucksvolle Einführung mit der sorbischen Trachtengruppe, der Videowanderung durch die Mark Brandenburg und dem Dialog. Ich glaube, das war eine gute Einstimmung für all das, was uns in den nächsten Tagen hier erwartet. Ich wünschte mir, wir könnten es dabei belassen und müßten nicht auch noch die anderen Diskussionen führen.
(Beifall)
Sie haben uns aber auch von den Problemen dieser Landschaft berichtet, von den Problemen Ostdeutschlands fast zehn Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Ich bin schon der Meinung, daß wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen müssen, daß auch diese Sozialmauer nun endlich eingerissen wird und wir gleiche Verhältnisse bekommen.
(Beifall)
Sehr eindrucksvoll haben Sie uns nicht nur die Geschichte der ärztlichen Vereinigungen in der Mark Brandenburg dargestellt, sondern auch die Initiativen, die hier zu einer raschen Installation einer funktionierenden ärztlichen Selbstverwaltung geführt haben. Ich kann mir vorstellen, daß mancher in Brandenburg und in den neuen Bundesländern angesichts dessen, was wir jetzt diskutieren, geradezu frustriert ist und die Welt nicht mehr versteht, weil er sich von der Vergangenheit wieder eingeholt fühlt.
(Beifall)
Die Probleme dieser Region haben aber auch Sie, Herr Oberbürgermeister Kleinschmidt, sehr deutlich dargestellt. Arbeitslosigkeit bis zu 25 Prozent in dieser Region, das ist schon gewaltig. Aber das hängt ebenfalls wieder mit dem zusammen, was wir hier diskutieren müssen, denn auch daraus resultieren natürlich die Probleme unserer sozialen Sicherungssysteme. Das kann dann letzten Endes zu Leistungseinschränkungen führen, auch wenn wir dies alles nicht wollen; das will ich niemandem unterstellen. Wir müssen uns deshalb gemeinsam bemühen, daß wir auch die Probleme lösen, die über die Medizin hinausgehen, und Verständnis gewinnen für das, was die Menschen hier beschäftigt, sie zum Bleiben in dieser schönen Landschaft auffordern und der Abwanderung entgegenwirken. Sie haben deutlich gemacht, daß Sie trotz all der Probleme durchaus positive Aspekte für die Weiterentwicklung dieser Region sehen. Dazu trägt der 102. Deutsche Ärztetag sicher in erheblichem Maße bei. Sie können sicher sein, daß die Publizität den Namen Cottbus durch Berichte, die eine Woche lang jeden Tag mehrfach erfolgen, in ganz Deutschland bekannt macht.
(Beifall)
Ihnen, Herr Ministerpräsident Stolpe, danke ich für das Angebot von Schlössern.
(Heiterkeit)
Wir haben hier erst einmal ein Einnahmeproblem bei den Krankenkassen. Aber dennoch, wir werden es überlegen; Sie wollen sie ja günstig verkaufen. Aber die Renovierungskosten übersteigen dann oft alles vorher Erwartete. Ich fürchte, das könnte auch beim Gesundheitswesen so sein.
(Beifall - Heiterkeit)
Wir sind mit Ihnen einig, daß wir natürlich Reformen brauchen, meinen aber, daß das in Selbstverwaltung geschehen soll und nicht alles nur übergestülpt werden darf. Wir dürfen Einsatz- und Risikobereitschaft der Ärzte nicht lähmen. Sie haben das beim Aufbau der medizinischen Versorgung hier deutlich hervorgehoben. Aber wenn alles nur von oben geregelt wird, geht auch diese Initiative verloren. Dem sollten wir entgegenwirken.
(Beifall)
Wir sind Ihnen sehr dankbar für die Aussage, daß medizinische Kriterien vor wirtschaftlichen Kriterien Vorrang haben müssen und daß das auch beim Referentenentwurf beachtet werden soll. Wir sind Ihnen dankbar für die Aussage, daß Sie Fachleuten doch einige Effizienz zumuten, die Kompromisse zusammentragen sollen. Wir wären Ihnen außerordentlich verbunden, wenn Sie diese konstruktive kritische Einstellung auch im Bundesrat vertreten würden.
(Beifall)
Mit Ihnen sind wir der Meinung, daß hier Konsens gefragt ist, daß kühle Köpfe gefragt sind und keine emotionale Eskalation stattfinden darf. Dieser sollten wir entgegenwirken, denn Emotion und vor allen Dingen Wut und ähnliches waren noch immer schlechte Ratgeber.
Frau Ministerin Fischer, ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind und daß Sie einiges Erklärende zu dem Verordnungsverhalten bei Arzneimitteln und auch zu Ihren sonstigen Ausführungen gesagt haben. Ich will Ihnen ja unterstellen, daß Sie all dieses gut meinen und wollen. Die Überschriften sind auch durchaus willkommen. Vieles davon kann die Ärzteschaft mittragen. Aber der Teufel steckt da im Detail. Ich bin sicher, daß wir darüber noch sehr viel mehr reden müssen. Es mag sein, daß Sie die zweimal anderthalb Stunden Diskussion und etwa eine Stunde mit dem "Focus" schon als "vieldiskutiert" betrachten.
(Beifall)
Mir fiele zu den notwendigen Maßnahmen aber noch viel, viel mehr Stoff ein, der zu diskutieren wäre, und da langt diese Zeit nicht. Wenn wir wirklich etwas zustande bringen wollen, dann ist viel mehr Zeit erforderlich. Schon von daher wird dieser Zeitplan überhaupt nicht einzuhalten sein, den Sie sich völlig unnötigerweise als Korsett umgezwungen haben.
(Beifall)
Noch eines möchte ich in aller Deutlichkeit hier sagen: Es geht nicht einfach nur um mehr Geld und schon gar nicht um mehr Einkommen für Ärzte.
(Beifall)
Wir brauchen sicher Strukturverbesserungen; da sind wir uns einig. Aber daß es nicht allein um mehr Geld geht, zeigen Ihnen doch auch die Demonstrationen von Pflegekräften, von Medizinisch-Technischen Assistenten, von Krankenhausärzten, von Krankenhausverwaltungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich könnte viele mehr aufzählen, deren persönliches Einkommen auf Gehaltsbasis oder durch Beamtenstatus geregelt ist. Sie haben insofern nichts davon. Sie sind nur von der tiefen Sorge getrieben, daß die Lösungen, die jetzt im Referentenentwurf erkennbar sind, zwingend dazu führen müssen, daß letzten Endes nicht die Finanzmittel für eine den heutigen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Möglichkeiten entsprechende ausreichende individuelle Versorgung zur Verfügung stehen.
(Beifall)
Da geht es gar nicht um eine irgendwie geartete Luxusversorgung. Wir sind auch nicht der Meinung, daß teuer immer auch gut ist. Umgekehrt sollte man aber auch nicht meinen, teuer sei nur unwirtschaftlich und nur billig sei gut.
(Beifall)
Wir müssen hier vernünftige Wege finden. Im Ziel mögen wir uns einig sein, aber über den Weg werden wir noch reden müssen. Wir kennen viele der verschlungenen Wege, der Stolpersteine auf dem Weg. Es mag sein, daß Sie den Weg als leichter beurteilen als wir. Aber wir sind seit inzwischen nahezu drei Jahrzehnten immer wieder neuen Reformansätzen durch den Gesetzgeber ausgesetzt und wissen auf Grund dieser längeren Erfahrung wahrscheinlich
sehr viel besser, worauf man hier im einzelnen achten muß, als Sie das nach den wenigen Monaten beurteilen können.
(Beifall)
Die Reformnotwendigkeit ergibt sich aus einer ganzen Fülle von Problemen. Wir müssen endlich aufhören, immer nur an den Symptomen herumzukurieren. Wir werden seit Mitte der 70er Jahre von einem "Jahrhundertgesetz" zum nächsten gejagt. Offenbar ist in unserer schnellebigen Zeit die Dauer eines Jahrhunderts inzwischen auf eine Legislaturperiode zusammengeschrumpft.
(Beifall - Heiterkeit)
Auch die Halbwertszeit für die Auswirkungen derartiger Gesetze hat sich dementsprechend drastisch verkürzt. Nicht selten ersetzen neue Bestimmungen gerade erst verabschiedete Regelungen, oft noch bevor die Auswirkungen in der täglichen Praxis bekanntwerden konnten, um daraus überhaupt Konsequenzen ziehen zu können. Das gilt jetzt zum Beispiel für die Umstellung auf andere Fallpauschalen: Nachdem man gerade Fallpauschalen und Sonderentgelte eingeführt hat, ein Forschungsvorhaben etabliert hat und die Ergebnisse des Forschungsvorhabens noch gar nicht allen bekannt sind, soll das ganze Verfahren schon wieder umgestellt werden. Ich kann darin keinen Sinn sehen. Dieses Verfahren scheint mir eher, ebenso wie die ganze Taktik der Nachbesserung bei vielen Gesetzen, die wir erleben, eine vor allem für Ministerialbürokratien, Medien und Verbände beschäftigungsintensive Variante zu sein.
(Beifall)
Daß diese Fülle ebenso hartnäckiger wie untauglicher Versuche, die "Gesundheit zu reformieren" – man fragt sich, ob das überhaupt möglich ist –,
(Heiterkeit)
die ungebrochene Leistungsdynamik des Gesundheitswesens nicht bremsen konnte, spricht eigentlich für die Leistungsfähigkeit unseres Systems und seiner sie tragenden Elemente.
(Beifall)
Es spricht noch mehr für das Engagement der in diesem Gesundheitswesen in den verschiedensten Bereichen tätigen Menschen.
(Beifall)
Doch gerade auf diese immer noch funktionierenden tragenden Elemente zielt nach unserer Auffassung die jetzt auf den Gesetzgebungsweg gebrachte Gesundheitsreform 2000 ab. Zweifellos entsprechen manche der thesenhaft formulierten Ziele auch Vorstellungen der Ärzteschaft, wie zum Beispiel die Stärkung der Rolle der Hausärzte unter Beachtung der freien Arztwahl; die bessere Zusammenarbeit von Hausärzten, Fachärzten und Krankenhäusern, auch durch gemeinsame Nutzung teurer Medizintechnik; der Vorrang von Rehabilitation vor Frühverrentung und Pflege; die Neuordnung des Arzneimittelmarktes; die Reform der ärztlichen Ausbildung und die Überprüfung der Berufsbilder der Medizinalfachberufe. Das klingt alles gut. Aber mit um so größerem Nachdruck müssen wir die systemverändernden Wirkungen ablehnen, die besonders durch die Einführung von Global- und Sektoralbudgets, die sich lediglich nach der Entwicklung beitragspflichtiger Einnahmen verändern, und die Machtverlagerung zu den Krankenkassen mit der Verfügungsgewalt über die Budgets und damit das gesamte medizinische Leistungsgeschehen, verbunden mit der Auflösung des Sicherstellungsauftrags, die daraus resultiert, zu erwarten sind.
Die Ärzteschaft fordert dagegen, das Prinzip einer beitragsfinanzierten patientenorientierten Versorgung und eines gegliederten Krankenversicherungssystems beizubehalten.
(Beifall)
Der in der Gesundheitsreform nach dem Referentenentwurf erkennbare Weg führt nämlich allmählich in eine Einheitsversicherung; das muß jedem klar sein.
(Beifall)
Wir fordern, die gemeinsame Selbstverwaltung zu erhalten und eventuell zu einer sektorübergreifenden Selbstverwaltung zu erweitern, aber nicht zu einer staatlichen Auftragsverwaltung zu degradieren.
(Beifall)
Wir fordern, eine gute hausärztliche Versorgung der Bevölkerung bei Wahrung der freien Arztwahl und der ärztlichen Unabhängigkeit zu verbessern, die Versorgungsstrukturen an die Fortschritte der Medizin anzupassen, sowohl durch eine bessere Integration zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich als auch durch die hierfür erforderliche Anpassung der Strukturen des ärztlichen Dienstes in den Krankenhäusern.
Nach der Bundestagswahl vom 27. September ist nach Ihren Worten, Frau Fischer, "eine Kehrtwende in der Gesundheitspolitik eingeleitet" worden. Die neue rot-grüne Regierungskoalition beabsichtigt, durch eine sozial gerechte Gesundheitspolitik ein leistungsfähiges und bezahlbares Gesundheitssystem, das auf dem Solidar- und Sachleistungsprinzip und einer paritätisch finanzierten Krankenversicherung für alle basiert, zu erhalten. Ich sage noch einmal: Diese freundlich formulierten Oberziele unterscheiden sich natürlich kaum von den Zielen der Ärzteschaft, doch der Teufel steckt im Detail.
Überstürzt und wohl mehr unüberlegt als zielgerichtet soll die gemeinsame Selbstverwaltung durch Machtverschiebung zu den Krankenkassen aus dem Gleichgewicht und damit ein leistungsfähiges, international anerkanntes Gesundheitssystem geradezu zum Einsturz gebracht werden.
(Beifall)
Nicht mehr der medizinische Versorgungsbedarf der Kranken soll das Leistungsgeschehen bestimmen, dies soll sich vielmehr nach den ökonomischen Interessen gesunder Beitragszahler richten.
(Beifall)
Vorstellungen, durch Wettbewerb Preissenkungen bewirken zu können, wandeln die soziale Krankenversicherung notwendigerweise zu gewinnorientierten Kassenunternehmen, die zudem über die Finanzbudgets und damit über Art und Umfang der Leistungen im Gesundheitswesen bestimmen sollen. Das eigentlich typischerweise von Versicherungen zu tragende Morbiditätsrisiko wird durch diese Machtverschiebung und durch die Festlegung von Global- oder Sektoralbudgets in der Verfügungsgewalt der Kassen von den Versicherungen auf die Leistungserbringer verlagert.
(Beifall)
Aufgaben und Selbstverständnis der Krankenkassen müssen sich dadurch völlig verändern. Vielleicht war ja der schon vor einigen Jahren vorgenommene Namenswechsel von "Krankenkasse" zu "Gesundheitskasse" bereits ein Signal in dieser Richtung.
(Beifall)
Gesetzliche Regelungen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, müssen sich doch auch bei knappen Ressourcen am Versorgungsbedarf der Patienten orientieren.
(Beifall)
Budgets müssen deshalb die Zunahme der Zahl älterer Menschen und deren erhöhten Behandlungsbedarf ebenso berücksichtigen wie die Veränderungen im Krankheitsspektrum mit einer Zunahme der Zahl chronisch Kranker, onkologisch Kranker und vieler anderer, die dauerbehandlungsbedürftig sind. Es muß der medizinische Fortschritt berücksichtigt werden, der auch künftig vielen Patienten in heute nahezu aussichtslosen Situationen eine wirksame Behandlung eröffnen könnte.
Nicht ausreichende oder wegen der Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen sogar rückläufige Budgets müssen zur offenen oder heimlichen Rationierung führen. Der Arzt muß dann dem Patienten medizinisch notwendige Leistungen verweigern. Eine Zuteilung von Gesundheitsleistungen oder die Ausgrenzung ganzer Alters- oder Krankheitsgruppen wäre dann, wie schon in anderen unterfinanzierten Gesundheitssystemen in Europa, auch in Deutschland die zwangsläufige Folge.
(Beifall)
Sie eröffneten dann bei den offenen Grenzen, die wir in Europa nun endlich haben, aber auch den direkten Weg in eine Mehrklassenmedizin. Für alle, die sich eine Behandlung im Ausland leisten können, wäre nichts zu befürchten. Andere, insbesondere chronisch Kranke, müßten dies mit dauerhaften Gesundheitsschäden oder sogar mit dem Leben bezahlen. Dies wäre eine neue Variante der schon vor über 20 Jahren öffentlich in den Medien verbreiteten Parole: "Weil du arm bist, mußt du früher sterben."
(Beifall)
Hier würde es jetzt heißen: "Weil deine Krankenkasse nicht mehr zahlen will oder politisch beschlossen ist, nicht mehr zu zahlen, mußt du früher sterben."
Leben und Gesundheit der Menschen dürfen nicht dem Dogma der Beitragssatzstabilität geopfert werden.
(Beifall)
Es wäre unerträglich, wenn sich trotz der öffentlich beklagten Zunahme der Zahl der Kranken die Mehrheit der Gesunden über die körperlichen und seelischen Nöte und Bedürfnisse Kranker und Hilfsbedürftiger hinwegsetzen sollte. Die Ärzteschaft jedenfalls lehnt einen solchen "Sozialdarwinismus" ab. Sie wird sich dieser Allianz der "Zahlungsunwilligen" entgegenstellen.
(Beifall)
Es muß bei all diesen Überlegungen doch auch mehr als bedenklich stimmen, wenn heute schon von "Überalterung" oder "Rentnerberg" gesprochen wird, weil dies den Eindruck vermitteln könnte, daß Menschen "zu alt" werden. Andere negieren den Einfluß dieser demographischen Entwicklung auf die Ausgabensteigerung und behaupten, größere Aufwendungen entstünden lediglich in den beiden letzten Jahren vor dem Tode, die Probleme seien also lösbar.
(Heiterkeit)
Man müsse nur bei diesem "Kostenkompressionsalter" ansetzen. Allerdings sagen sie nicht, wer denn die Verantwortung für die Entscheidung auf sich nehmen soll, wann die letzten beiden Jahre vor dem Tode beginnen.
(Beifall - Heiterkeit)
Wir alle wissen doch, daß medizinischer Einsatz oft gerade bewirkt, daß noch nicht die letzten zwei Jahre vor dem Tode beginnen.
(Beifall)
Viele haben dann noch Jahre oder Jahrzehnte vor sich.
Auch durch Rationalisierungsmaßnahmen lassen sich langfristig rein ökonomisch bestimmte Ausgabensteigerungen nicht kompensieren. Sie bringen Ärztinnen und Ärzte außerdem in Konflikte zwischen Sozial- und Haftungsrecht. Budgetierung führt also zwangsläufig zur Rationierung mit Zuteilung von Leistungen. Finanzbudgetierung wird über eine solche Leistungsbudgetierung schließlich eine "Lebenszeitbudgetierung" zur Folge haben, und ein so provoziertes "sozialverträgliches Frühableben" darf doch nicht Ziel einer humanen Gesundheitspolitik sein!
(Lebhafter Beifall)
Unser ständiges Monitum an die Politik ist daher, daß sie den Bürgern diese Zusammenhänge endlich darstellen soll, statt sie zu verheimlichen.
(Beifall)
Statt dessen erleben wir aber immer wieder, daß in populistischer Habachtstellung mit erhobenem Zeigefinger des Haushaltsvorstandes die Parole ausgegeben wird: Wir können nicht mehr ausgeben, als wir bei stabilen Beitragssätzen einnehmen. Den Folgesatz vergißt die Politik: Weil wir nicht mehr ausgeben wollen, können wir uns auch nicht mehr alles leisten. Wie in allen Lebensbereichen gilt also auch hier: Wer budgetiert, rationiert.
(Beifall)
Im übrigen – aber das wäre eine allgemeinpolitische Anmerkung – könnte man auf die Idee kommen, daß der Staat uns geradezu vormacht, daß man durchaus mehr ausgeben kann, als man einnimmt.
(Beifall - Heiterkeit)
Völlig unvernünftig und zum Teil widersprüchlich ist auch das umfassende bürokratisch-formalistische Qualitätsmanagement für Vertragsärzte, zugelassene Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, das die Rationierungsprobleme letztlich nur weiter verschärfen wird.
(Beifall)
In der Begründung für diese Vorschriften ist zu lesen:
Da zu einem umfassenden Qualitätsmanagement auch eine standardisierte und ausführliche Dokumentation von erbrachten Leistungen gehört, müssen die Richtlinien auch Standards für eine aussagekräftige systematische Dokumentation der Krankendatei vorsehen.
Dieser Dokumentations- und Durchführungsaufwand erfordert aber unendlich viel Zeit und Geld, und vor allem entzieht er unter Budgetbedingungen dringend benötigte Ressourcen der eigentlichen Patientenversorgung.
(Beifall)
Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Die Ärzteschaft hat sich seit jeher für eine möglichst gute Qualität ärztlicher Arbeit eingesetzt, allerdings dabei bewußt auf politisches Getöse verzichtet.
(Beifall)
Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen aus Zeiten, als Qualitätssicherung noch kein Modebegriff geworden war, sind ein beredtes Zeugnis dafür. Gerade deshalb fordert die Ärzteschaft aber auch seit langem den Gesetzgeber auf, den durch ihn selbst geschaffenen gesetzlichen Kompetenzwirrwarr wieder zu beseitigen.
Die Selbstverwaltung von Krankenkassen, Deutscher Krankenhausgesellschaft und Ärzteschaft hat zwischenzeitlich – trotz interpretierbarer, sage ich ganz vorsichtig, gesetzlicher Bestimmungen – durchaus funktionsfähige Regelungen vertraglich vereinbart, die medizinische Qualitätssicherungsaspekte nun endlich einschließen. Dies alles würde jetzt wieder zerstört. Die Bundesärztekammer wird zwar erwähnt, es muß ihr aber lediglich "Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben" werden. Krankenkassen und Krankenhausträger, also administrative Spitzen dieses Gesundheitswesens, können dann alles weitere "im Benehmen" mit der Ärzteschaft regeln – das heißt, es wird ein Brief geschrieben.
(Beifall - Heiterkeit)
Medizinische Gesichtspunkte zur Qualitätssicherung, um vor allem Behandlungsmaßnahmen weiter zu verbessern oder noch sicherer zu machen, wie zum Beispiel Untersuchungen über funktionelle Endergebnisse, Mortalitäts- oder Infektionsraten, haben dagegen offenbar nur geringe Bedeutung. Durch diese vorgesehene Dokumentation werden riesige Datenfriedhöfe bewirkt, und auch fehlende Bewertungskonzepte helfen schließlich keinem einzigen Patienten. Daher sind diese Qualitätssicherungsmaßnahmen reine Geldverschwendung.
(Beifall)
Eine Verschärfung der Rationierung wird unter Budgetierungen die für das Jahr 2002 vorgesehene Einführung einer rein monistischen Krankenhausfinanzierung ebenfalls bringen. Wenn die Länder nach verschiedenen Schätzungen um 2,3 Milliarden DM bis zum Jahr 2002 und um weitere 4,5 Milliarden DM bis zum Jahr 2008 entlastet werden, wird damit doch das Budget um den gleichen Betrag belastet. Denn es steht nirgends, daß entsprechend ausgeweitet wird. Auch diese Milliarden fehlen dann bei der Patientenversorgung.
(Beifall)
Die finanzielle Entlastung der Länder führt also zur Belastung der Kranken. Das ist nach meiner Auffassung wahrhaftig "soziale Ellenbogengesellschaft".
(Beifall)
Die jetzt in § 116 a des Referentenentwurfs vorgesehene Öffnung der Krankenhäuser für ambulante Behandlung bei "schweren Krankheitsbildern mit komplizierten Verläufen und bei hochspezialisierten Leistungen" auf der Grundlage eines von den Selbstverwaltungen zu vereinbarenden Katalogs entspricht diesen Forderungen jedoch kaum. Im Gesetzentwurf heißt es zwar:
Die ermächtigten Krankenhäuser haben sicherzustellen, daß die vertragsärztlichen Leistungen ausschließlich durch Krankenhausärzte mit abgeschlossener Weiterbildung erbracht werden.
Doch diese Formulierung läßt nicht erkennen, was eigentlich wie geregelt werden soll. Wenn die abgeschlossene Weiterbildung Voraussetzung für solche Leistungen wäre, könnte das sofort beim niedergelassenen Facharzt geschehen, denn der hat seine Weiterbildung.
(Beifall)
Es geht doch um ganz bestimmte Verrichtungen. Deswegen ist weitaus klarer, was der 101. Deutsche Ärztetag und die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung schon vor einem Jahr in einer Entschließung festgelegt haben, nämlich daß man zur Verbesserung der Integration entsprechend qualifizierte und spezialisierte Krankenhausärzte ermächtigen muß, bestimmte Leistungen, deren fachgerechte Erbringung zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die Patienten die Infrastruktur eines Krankenhauses oder eine entsprechende intensivmedizinische Struktur oder Spezialwissen erfordern, sowohl stationär als auch ambulant zu erbringen.
(Vereinzelt Beifall)
Das wäre die einzige sinnvolle Regelung. Man muß das auf Personen beziehen. Ich habe auch noch nie gesehen, daß Häuser Menschen behandeln.
(Beifall - Heiterkeit)
Zu diesen Leistungen gehören insbesondere Leistungen der interventionellen Kardiologie, der interventionellen Gastroenterologie, der interventionellen Radiologie, Versorgung spezieller onkologischer Patienten, Versorgung spezieller Formen der Aidserkrankung. Man kann auch über weitere Dinge reden.
Die notwendigerweise kostenaufwendige Infrastruktur eines Krankenhauses und die in Deutschland bewährte Struktur einer wohnortnahen fachärztlichen Versorgung durch als Kassenärzte zugelassene Fachärzte steht doch einer generellen Öffnung für die fachärztliche ambulante Versorgung auch bei schwer definierbaren "schweren Krankheitsbildern mit komplizierten Verläufen und bei hochspezialisierten Leistungen", wie es dort heißt, entgegen. Das sind doch reine Kautschukbegriffe.
(Beifall)
Abgesehen davon kann schon heute die Versorgung der stationären Patienten – davon wird viel zuwenig geredet – im Krankenhaus nur durch die Ableistung von Millionen unbezahlter und auch nicht in Freizeit abzugeltender Überstunden aufrechterhalten werden.
(Beifall)
Die Krankenhausärzte erbringen so geldwerte Geschenke an die Gesellschaft in Millionenhöhe, in Milliardenhöhe.
(Beifall)
An dieser Tatsache sehen Sie doch, daß es den Ärzten, in Klinik, Praxis oder wo immer sie tätig sind, nicht einfach um ärztliche Einkommen geht. Wir wollen aber auf Dauer nicht tolerieren, daß ärztliche Arbeitskraft in dieser Form ausgeplündert wird.
(Beifall)
Ich schließe da die anderen im Krankenhauswesen Tätigen, Pflegekräfte, MTAs, Krankengymnastinnen und wer da alles nötig ist, durchaus mit ein; auch sie trifft vielfach das gleiche Schicksal.
(Beifall)
Bevor also das Krankenhaus mit weiteren Aufgaben belastet wird, sollten Gesetzgeber und Tarifpartner der öffentlichen Hand – das sind nämlich Bund, Länder und Gemeinden – zunächst einmal dafür sorgen, daß die von ihnen selbst verabschiedeten und unterschriebenen gesetzlichen oder tarifvertraglich vereinbarten Bestimmungen im Krankenhaus überhaupt eingehalten werden können.
(Beifall)
Bei den Überlegungen für eine grundlegende Gesundheitsreform 2000 muß also endlich Schluß sein mit den jetzt schon jahrzehntelang zumeist ideologisch geprägten gesundheitspolitischen Humanexperimenten.
(Beifall)
Man fragt sich doch allmählich nicht nur nach der Zweitmeinung, sondern auch danach, warum zum Beispiel die Einführung einer neuen Kopfschmerztablette von einer Ethikkommission begutachtet werden muß, Einführung und Folgen politischer Entscheidungen einem solchen Votum jedoch nicht unterzogen werden.
(Beifall)
Ebensowenig gibt es dort eine produktbegleitende Forschung, aus der Konsequenzen zu ziehen wären, oder gar Qualitätssicherungsmaßnahmen mit
Sanktionsmechanismen.
(Beifall - Heiterkeit)
Auch eine von der Gesundheitsministerkonferenz geplante Regelung von Patientenrechten mit dem Ziel, den Patientenschutz zu verbessern, gehört in diese "Reform"-Kategorie. Selbst wenn von einigen Leuten immer wieder behauptet wird, Deutschland sei bei der Entwicklung einer "Patientencharta" rückständig, sind doch die Patientenrechte in Deutschland durch Gesetz und Rechtsprechung heute schon wesentlich besser ausgebaut als in vielen Ländern der Welt.
(Vereinzelt Beifall)
Angeblicher Patientenschutz und Regelungen in einer Patientencharta spielen doch besonders in den Ländern eine große Rolle, in denen, wie in Großbritannien, Gesundheitsleistungen rationiert sind und Patienten mit bestimmten Krankheiten oder bei Überschreiten zum Beispiel des 70. Lebensjahres Leistungen vorenthalten werden. Durch eine Patientencharta wird all dies dann verschleiert; die Öffentlichkeit kann es nicht erkennen. Durch eine so unterlassene Hilfeleistung wird die Gefahr eines vorzeitigen Todes erhöht. Mit einer solchen Leistungsrationierung ist dann – auch das muß man im europäischen Zusammenhang sehen – der Weg zu einer angeblich freiwilligen Euthanasie, wie in den Niederlanden, nicht mehr weit.
(Beifall)
Dies aber ist für die deutsche Ärzteschaft ethisch nicht vertretbar. Sie wird deshalb solchem Ansinnen entgegentreten.
(Beifall)
Wer den neuen § 136 im Entwurf genau liest, entdeckt einen Perspektivwandel. Wissenschaftlich-medizinische Leitlinien sollen zu einer wirtschaftlich sinnvollen Diagnostik und Behandlung anleiten. Dies wäre also der erste Gesetzgeber, der sich anmaßt, Wissenschaft politisch zu bestimmen. Einen Vorgeschmack haben wir ja schon mit den Vorwürfen wegen der Antibiotikaverordnung bei Grippe zu spüren bekommen.
(Beifall)
Ich frage mich, ob das dann so weitergehen soll. Ich will dieses Thema aber jetzt wegen Ihrer Erklärung vorhin nicht vertiefen.
Aufklärung des einzelnen Patienten über Chancen und Risiken von Behandlungsmaßnahmen gehört für Ärztinnen und Ärzte zu den Berufspflichten. Aus der ethischen Verantwortung ergibt sich aber auch eine Aufklärungspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, wenn politisch nach dem Dogma der Beitragssatzstabilität bestimmte Maßnahmen Gefahren oder gar Schäden für die Bevölkerung heraufbeschwören.
(Beifall)
Nichts anderes war auch das Ziel der Kampagne, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geplant war.
(Beifall)
Im übrigen: Wer weiß denn, ob der Bürger angesichts der zu erwartenden Folgen wirklich eine starre Beitragssatzfixierung will?
(Vereinzelt Beifall)
Ist es nicht denkbar, daß vor einer rein politisch verordneten Rationierung eine andere Werteentscheidung erfolgt?
(Beifall)
Die rund 500 Milliarden DM, die in Deutschland insgesamt für Gesundheit ausgegeben werden und damit fast das Doppelte der Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung betragen, zeigen doch ganz deutlich, daß Bürgerinnen und Bürger ganz andere Prioritäten setzen als die von der Politik verordneten.
(Beifall)
Starken wirtschaftlichen Druck auf Patienten und Ärzte bewirkt auch der im Entwurf für eine Gesundheitsreform 2000 vorgesehene Wettbewerb der Krankenkassen und deren Handlungsallmacht. Sie führt zur Aushöhlung des Sicherstellungsauftrages der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften, und das auch dann, wenn Sie, Frau Fischer, – mit besten Absichten - sagen, Sie wollen die Selbstverwaltung erhalten. Sie wird ausgehöhlt.
(Beifall)
Die Bestimmung des medizinischen Leistungsspektrums nach ökonomischen Vorgaben allein durch die Krankenkassen ist gleichsam der Weg in die Leibeigenschaft der Patienten.
(Beifall)
Mündige Bürger werden so zu unmündigen Patienten, über deren Wohl und Wehe Krankenkassenfunktionäre bestimmen.
(Beifall)
Eine moderne, zuwendungsintensive Versorgung erfordert neben der freien Arztwahl durch den Patienten die Therapiefreiheit des Arztes und einen Schutz des Patient-Arzt-Verhältnisses. Die im Entwurf vorgesehene Vermittlung intimer Gesundheitsdaten an die Krankenkassen ist damit nicht vereinbar.
(Beifall)
Das Arztgeheimnis ist nämlich kein Privileg des Arztes, sondern ein fortgeleitetes Patientenrecht, das zu wahren ist.
(Beifall)
Nach der seit Mitte der 70er Jahre einsetzenden Vergötzung der Technik in der Medizin wird nach einem neuerlichen Paradigmenwandel nunmehr wiederum eine zuwendungsintensive Medizin gefordert. Sie ist ohne gesichertes Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt nicht denkbar. Der Patient muß sicher sein, daß seine dem Arzt offenbarten Intimdaten und Geheimnisse auch Geheimnis des Arztes bleiben, wie es im übrigen seit zweieinhalbtausend Jahren der Hippokratische Eid fordert. Sollte der Gesetzgeber das verändern, hätte dies tiefgreifende Folgen für die Vertrauensbeziehung zwischen Patient und Arzt. Der Arzt wäre dann nämlich nicht mehr dem
Wohl des einzelnen Patienten verpflichtet, sondern er würde damit zum Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen degradiert.
(Beifall)
Das wird dann das Arztbild in der Öffentlichkeit und auch das Selbstverständnis jedes einzelnen Arztes wie der Gesamtärzteschaft maßgeblich verändern können.
Der Arztberuf hat sich seit langem, weitgehend losgelöst von Zeitströmungen, Weltanschauungen und politischen Gesellschaftssystemen, zu einer einheitlichen und im wesentlichen unveränderten ärztlichen Berufsethik bekannt. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über einzelne Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, deren Wirksamkeit, Unbedenklichkeit oder Wirtschaftlichkeit und trotz immer noch unaufgeklärter Zusammenhänge menschlichen Lebens gab und gibt es in der Welt eine im wesentlichen einheitliche Auffassung über das Ziel ärztlichen Handelns. Eine wechselnden gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen ausgesetzte "opportunistische Ethik" ist dem ärztlichen Berufsstand im ganzen fremd.
(Beifall)
Daran ändert sich auch nichts, wenn einzelne Ärzte gegen die gebotenen Maximen ärztlichen Handelns verstoßen. Denn unter ethischen Gesichtspunkten sind die zu fordernden Maximen seit Bestehen des Arztberufs im Grundsatz unbestritten.
Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen ebenso wie die erstaunlichen Entwicklungen in der Medizin haben dennoch Wirkungen auf das Arztbild und das Selbstverständnis der Ärzte gezeigt. Die äußeren Rahmenbedingungen veränderten sich insbesondere seit der kaiserlichen Botschaft vom November 1881 und der Gesetzgebung der Krankenversicherung der Arbeiter vom Juni 1883. Ursprünglich waren nur rund 10 Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung abgesichert. Dieser Anteil stieg in der Folge zweier Weltkriege, anschließender Inflation und Währungsreformen, aber auch aus politischer Motivation auf heute nahezu 95 Prozent der Bevölkerung an. Deshalb bestimmt das für die gesetzliche Krankenversicherung zunehmend engmaschiger gestaltete Regelwerk heute den ärztlichen Alltag in Praxis und Klinik. Es wirkt sich sogar auf die privatversicherten Patienten und die für diese geltende amtliche Gebührenordnung aus.
Nennenswerte Betätigungsmöglichkeiten außerhalb des Kreises der gesetzlich Krankenversicherten finden sich also heute für den Arzt in der Regel nicht mehr. Der Arzt, insbesondere der niedergelassene Vertragsarzt, ist so mehr und mehr von den Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherung abhängig geworden. Die gemeinsame Selbstverwaltung hält dies heute noch einigermaßen in Balance, aber gerade sie soll jetzt abgeschafft werden. Wie soll sich das Arztbild dann verändern? Wir werden andere Ärzte haben, und ich weiß nicht, ob die Patienten damit so zufrieden wären wie mit den heutigen Ärzten.
(Beifall)
Doch auch die eigentliche ärztliche Tätigkeit hat sich natürlich verändert. Früher erfolgte ärztliche Behandlung zumeist im häuslichen Bereich der Patienten durch einen Tag und Nacht für sie zuständigen Hausarzt. Spezialisierung und Differenzierung der ärztlichen Tätigkeit sowie der Einsatz komplizierter und kostenintensiver Technik haben eine Konzentration in Arztpraxen und Krankenhaus erfordert. Die sprunghaften Fortschritte bei der Behandlung von Patienten haben dann eine Vielzahl neuer Methoden, aber auch ungeahnte Probleme mit sich gebracht, so daß sich die Arbeit der Ärzte auch strukturell insgesamt erheblich verändert hat. Häufig ist ein intensives Zusammenwirken mehrerer Spezialisten für einen Patienten gleichzeitig oder nacheinander erforderlich, ein Privileg, das früher nur regierende Fürsten hatten. Dieses Zusammenwirken erfordert aber nicht nur das Vertrauen des Patienten in die ihn behandelnden Ärzte, sondern auch das Vertrauen der behandelnden Ärzte untereinander als Voraussetzung für kollegiales Zusammenwirken und für die Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Berufsbild Arzt. Dies darf nicht durch eine fremdbestimmte und fremdgeregelte Leistungsbestimmung gefährdet werden.
(Beifall)
Durch die Mitwirkung kompetenter Ärzte und durch die Konzentration kostenintensiver Infrastruktur, die im häuslichen Bereich nicht mehr vorgehalten werden konnte, entwickelten sich aus den früheren Siechenhäusern allmählich Krankenhäuser. Die Veränderungen in der Gesellschaft, insbesondere der Familien- und Wohnstrukturen, förderten ebenso eine weitere Verlagerung von Leistungen in das Krankenhaus. Dort wurde zur Bewältigung der Arbeit immer mehr ärztliche Arbeitskraft benötigt. Der leitende Arzt blieb zwar ursprünglich tatsächlich der allein behandelnde Arzt. Damit aber die Arbeit bewältigt werden konnte und gleichzeitig, um Erkenntnisse vertiefen und Erfahrungen sammeln zu können, waren in größerer Zahl junge Ärzte dabei, die sich zumeist aber nach recht kurzer Zeit in eigener Praxis niederließen.
Die Arbeitsbedingungen mit Auswirkungen auf die ärztliche Berufsbiographie änderten sich in den vergangenen vier Jahrzehnten dadurch nachhaltig. Meilensteine dafür waren: das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1960 mit der Aufhebung der als verfassungswidrig bezeichneten Verhältniszahl, das Inkrafttreten des Bundes-Angestelltentarifvertrages am 1. April 1961 – dadurch wurde die Arbeitszeit erstmals auf 60 Stunden begrenzt, zu einer Zeit, als für die übrige Bevölkerung 48 Stunden längst selbstverständlich waren –, aber auch die Einführung von Einzelleistungsvergütungen bei den niedergelassenen Ärzten, mit der die Ausstattung in den Praxen mit technischem Gerät von Krankenkassen, Politik und anderen bewußt gefördert wurde, um der in den Medien verbreiteten Parole "Opas Praxis ist tot" entgegenzutreten. Heute wird so getan, als habe sich der Arzt in die Technik geflüchtet und sie nur zum Gelderwerb angeschafft. Dies ist doch einfach nicht wahr.
(Beifall)
Die durch die Spezialisierung veränderten Arbeitsmöglichkeiten bewirkten Verschiebungen der Anteile der im Krankenhaus und in freier Praxis tätigen Ärzte. Die Zahl der Krankenhausärzte hat sich seit 1960 verfünffacht. Die Zahl der in eigener Praxis tätigen Ärzte hat sich lediglich verdoppelt, und auch die Zahl der leitenden Ärzte im Krankenhaus hat sich nur verdoppelt. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Krankenhausärzte sank dadurch von ursprünglich 18 Prozent auf heute nur noch 9 Prozent. Wenn jedoch weiterhin nahezu 90 Prozent der im Krankenhaus tätigen Ärzte nach jeweils vier bis zehn Jahren, also nach etwa einem Drittel ihrer Lebensarbeitszeit, wegen befristeter Verträge das Krankenhaus verlassen müssen, um die folgenden zwei Drittel ihrer Lebensarbeitszeit in eigener Praxis wirken zu müssen, müssen die Arztzahlen in der Praxis stark ansteigen. Denn auch die Zahl der Krankenhausärzte beträgt nicht mehr, wie 1960, lediglich ein gutes Viertel der Ärzteschaft, sondern übersteigt die Zahl der niedergelassenen Ärzte inzwischen deutlich.
Für den Gesetzgeber war dies alles wiederum nur Anlaß, an Symptomen zu kurieren und ab 1993 Zulassungssperren bei Überversorgung sowie ab 1999 die Zulassung nach Verhältniszahlen einzuführen. Ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte ist damit künftig nach Abschluß ihrer Weiterbildungszeit, also etwa ab dem 35. Lebensjahr, ohne jede berufliche Perspektive.
(Beifall)
Die daraus resultierende Frustration und Desillusionierung ist durch ein internationales Kooperationsprojekt des Berliner Forschungsverbundes "Public Health" in Zusammenarbeit mit der Berliner Ärztekammer und dem "Institut für Gesundheitsförderung" in Österreich erkennbar geworden. Sie ist unter dem Titel "Ende eines Traumberufs" eindrucksvoll beschrieben. So etwas verändert nachhaltig das Arztbild. Das muß uns allen klar sein.
Perspektivlosigkeit der beruflichen Zukunft kann ebenso wie zunehmende Reglementierung der Berufsausübung nicht ohne Auswirkung auf das ärztliche Selbstverständnis bleiben. Schon heute empfinden sich doch nicht wenige niedergelassene Vertragsärzte geradezu als Angestellte der Krankenkassen. Weitere Reglementierungen werden weder an den Ärzten im Krankenhaus noch an den niedergelassenen Ärzten spurlos vorbeigehen. Insoweit hat Karl Marx recht: Das Sein bestimmt das Bewußtsein.
(Beifall)
Leistungs- und Einsatzbereitschaft werden dabei aber gelähmt, Wartelisten für Patienten sind die Folge. Dies belegen doch eindrucksvoll die Entwicklungen in anderen staatlichen, zumeist unterfinanzierten Gesundheitssystemen in Europa.
(Vereinzelt Beifall)
Die Ärzteschaft hat dies frühzeitig erkannt und Reformen gefordert. Viele der heute beklagten Probleme wären bei rechtzeitiger Anpassung der Versorgungsstrukturen nicht entstanden oder hätten mindestens nicht dieses Ausmaß angenommen.
(Beifall)
Die Fehlentwicklungen wurden zum Teil aber auch politisch gefördert. Wenn der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rudolf Dreßler heute moniert, daß sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte seit 1960 verdreifacht habe, ist dies zunächst einmal falsch, denn die Zahl hat sich, wie ich eben sagte, bis heute verdoppelt. Die Steigerung durch den Beitritt der neuen Bundesländer darf man in diesen Vergleich doch nicht einbeziehen.
(Vereinzelt Beifall)
Zum anderen muß man Rudolf Dreßler daran erinnern, daß bis Ende der 70er Jahre und sogar noch bis Anfang der 80er Jahre von der Politik ein großer Ärztemangel beklagt wurde, der zu einer politisch gewollten Steigerung der Medizinstudentenzahlen beitrug. Die schon damals von der Ärzteschaft vorhergesehene viel zu starke Steigerung der Arztzahlen wurde mit dem Bemerken abgetan: "Solange in Deutschland noch ein Patient eine halbe Stunde auf einen Arzt wartet, gibt es zuwenig Ärzte."
(Beifall)
Hier hat man sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen.
Trotz dieser auch für die ärztliche Selbstverwaltung häufig frustrierenden Erlebnisse gehört es aber zu den Aufgaben dieser ärztlichen Selbstverwaltung, bei den politisch Verantwortlichen weiterhin auf sachgerechte Reformen im Gesundheitswesen zu drängen. Sie werden nicht durch parteipolitisch motivierte Pirouetten zu erreichen sein, sondern sie erfordern eine wirkliche Kehrtwende in der Gesundheitspolitik. Anderenfalls werden sowohl Patienten als auch Ärzte von Politik und Krankenkassen entmündigt.
(Beifall)
Eine emotionsfreie Beurteilung erfordern auch Forschung und neue Entwicklungen in der Medizin, die weitere Fortschritte, aber auch viele neue, bislang ungelöste ethische und rechtliche Probleme mit sich bringen. Erinnert sei an die prädiktive genetische Diagnostik oder die somatische Gentherapie. In den durch den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer dafür erarbeiteten Richtlinien wird betont, daß jede genetische Untersuchung freiwillig bleiben muß. Anerkannt wird ausdrücklich das "Recht auf Nichtwissen und die informationelle Selbstbestimmung" der Patienten.
Dies gilt aber auch für viele mit der Reproduktionsmedizin und dem Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik zusammenhängenden Fragen, wie zum Beispiel der Gefahr einer Menschenauswahl oder der mit einem Schwangerschaftsabbruch im fortgeschrittenen Stadium verbundenen Probleme. Bei der traditionellen mütterlich-medizinischen Indikation war die Tötung des Kindes nicht das Ziel, immer aber die unvermeidliche Konsequenz. Bei der jetzt in die medizinische Indikation integrierten "embryophatischen" Indikation ist jedoch durchaus die Tötung des Kindes gemeint. Die in den vergangenen Jahren festzustellende Ausweitung der medizinischen Indikation im Abtreibungsrecht ist ein Paradebeispiel dafür, daß politische Formelkompromisse oft mehr Schaden anrichten, als Politiker wahrhaben wollen.
(Beifall)
Die Entwicklungen in der Molekularbiologie lassen erwarten, daß sich in wenigen Jahren das Verständnis über die Entstehung und Behandlung mancher Krankheiten grundlegend wandeln wird und damit vielleicht auch eine gezieltere und wirksamere Prävention als heute ermöglicht wird. Weitere Forschung ist deshalb unverzichtbar. Dazu gehört auch – unter strengen Kriterien – die Forschung an Nichteinwilligungsfähigen, um deren Krankheiten wirksam behandeln oder verhindern zu können. Denn wir sind auch nicht berechtigt, diese Menschen aus unserem Versorgungssystem auszugrenzen.
(Beifall)
Bei der Forschung sind die bewährten "Grundsätze des Genfer Gelöbnisses des Weltärztebundes" ebenso zu beachten wie die Deklaration von Helsinki zur biomedizinischen Forschung am Menschen. Diese sollte zwar neueren Entwicklungen angepaßt, jedoch nicht grundlegend verändert werden.
Zu begrüßen sind deshalb auch die Bestrebungen in der sogenannten "Bioethikkonvention" des Europarates, Mindestnormen zu vereinbaren, die in den einzelnen Staaten nicht unterschritten werden dürfen.
Die Politik ist mit vielen dieser notwendigen Regelungen überfordert; sie sollte sich statt dessen den nur von ihr zu regelnden Fragenkomplexen zuwenden, sich mit Rahmenvorschriften begnügen, sich dabei von Fachleuten sachkundig beraten lassen und sich nicht völlig gegenüber Vorschlägen und Forderungen verschließen. Manche Politiker müssen vielleicht auch erkennen, daß Ethik und Recht nicht nach tagespolitischer Opportunität zurechtgebogen oder dieser gar geopfert werden dürfen.
(Beifall)
Der Gesetzgeber sollte deshalb nicht dort tätig werden, wo die Ärzteschaft die ethischen Anforderungen an ärztliches Handeln berufsrechtlich verbindlich selbst festlegen kann. Ethisches Verhalten läßt sich nämlich nicht durch gesetzliche Normen festschreiben oder gar erzwingen. Wir wehren uns deshalb dagegen, das gesamte ärztliche Handeln praktisch strafrechtlich durchzunormieren.
(Beifall)
Die Ärzteschaft wird ihre auf Grund klarer Analysen und logischen Denkens entwickelten, an einer zugleich humanen wie effizienten Patientenversorgung orientierten Reformvorstellungen im Vertrauen auf die eigene Leistung und im Interesse der Patienten mit Nachdruck vertreten. Alle diejenigen, denen an der Würde des Menschen liegt, sind aufgefordert, sich gemeinsam dafür einzusetzen, daß der Mensch nicht Objekt einer Verwaltung wird und dann schutzlos wechselnden, jedoch immer fremden Herrschaftseinflüssen preisgegeben wird.
(Beifall)
Dies erfordert die ärztliche Ethik besonders in unserem Wohlfahrtsstaat, man kann fast schon sagen: Versorgungsstaat. Das ist die aus moralischer Verpflichtung entstehende politische Aufgabe des Arztes.
Es gab und gibt viele Reformversuche. Ich will sie nicht alle bewerten. Aber über einen Grundsatz sollten wir unter allen politisch Beteiligten doch einig sein: Wer das bestehende System ändern, ja, wie jetzt, ablösen will, ist vorab beweispflichtig für die beabsichtigte Verbesserung.
(Beifall)
Ich kann dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dem Kollegen Winfried Schorre, nur zustimmen, der gestern auf der Vertreterversammlung gesagt hat: Wir verschließen uns einem politischen Dialog nicht, aber wir werden uns nicht mehr an Alibiveranstaltungen beteiligen.
(Beifall)
Den gesetzgeberischen Eigensinn mit den aufgezeigten Konsequenzen für die Versorgung und die Angriffe auf unsere Selbstverwaltung, die unsere Tätigkeit motivierende Freiberuflichkeit und auf unser ärztliches Selbstverständnis werden wir nicht tolerieren.
(Beifall)
Herr Schorre schloß dann mit der Feststellung: Wer die Macht hat, bestimmt nicht allein, was die Wahrheit ist.
(Beifall)
Darin stimmen wir, lieber Herr Schorre, sicher auch in Zukunft alle überein.
Dies ist die erste Reform – das muß man leider sagen –, welche ohne Not und mit voller Absicht ein Experiment mit fatalem Ausgang einleitet.
(Beifall)
Man kann das ideologische Arroganz nennen.
(Beifall)
Andere würden sagen: fahrlässiger Umgang mit den Bürgern.
(Beifall)
Niemand unter den politisch Verantwortlichen soll sagen, daß er nicht gewarnt worden sei, wenn wir in einigen Jahren den Niedergang unseres Gesundheitswesens mit seinen freiheitlichen und humanen Strukturen feststellen müssen.
(Beifall)
Noch ist es Zeit. Ich kann Ihnen, Frau Bundesministerin Fischer, nur raten: Sie sollten dieses Experiment nicht zulassen, sondern nach ausführlicher Diskussion mit allen Beteiligten eine wirkliche Reform einleiten.
(Beifall)
Ich kann Ihnen nur sagen: Nehmen Sie die Kritik auf. Sie ist konstruktiv gemeint. Als Arzt sage ich: Realitätsimmunität scheint bei Politikern eine Krankheit zu sein.
(Beifall - Heiterkeit)
Sie aber haben das große Glück, sich hier unter Ärzten und Experten zu befinden. Wir können Sie davon heilen, wenn Sie auf unseren Rat hören.
(Beifall - Heiterkeit)
Das ist sicher ein ehrliches Angebot der Ärzteschaft an die Politik, insbesondere an das Bundesministerium für Gesundheit.
Damit, meine Damen und Herren, ist der 102. Deutsche Ärztetag eröffnet. Ich danke Ihnen.
(Anhaltender lebhafter Beifall)
Ich bitte Sie nun, sich zum Singen der Nationalhymne von Ihren Plätzen zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich und singen die Nationalhymne)