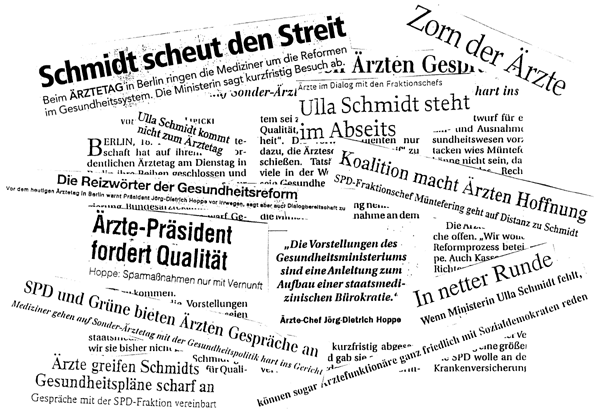|
Konfrontation und Kooperation in der Gesundheitspolitik |
|
Wer gibt den Ton an in der rot-grünen Gesundheitspolitik? Bis weit in das Jahr 2002 hinein hätten die meisten Beobachter der Szene vermutlich Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt diese Richtlinienkompetenz zugewiesen. Spätestens aber mit der Einsetzung der Regierungskommission zur nachhaltigen Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme (Rürup-Kommission) im November 2002 und dem Bekannt werden eines gezielt in die Öffentlichkeit lancierten Strategiepapiers aus dem Bundeskanzleramt Ende des Jahres 2002 sind daran Zweifel angebracht. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben, sodass ein parteiübergreifender Konsens möglich erscheint. Durch den Sieg bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen am 2. Februar 2003 hat die Union deutlich an Gewicht gewonnen. Stärker als bisher schon kann die Opposition über den Bundesrat Einfluss auf das anstehende Gesetzgebungsverfahren zur Reform des Gesundheitswesens nehmen. Folgerichtig hat die Bundesregierung der Union bereits Gespräche angeboten. Auch wurde das ursprüngliche Konzept von Bundesgesundheitsministerin Schmidt, lediglich eine „Ausgabenstrukturreform“ vorzunehmen, durchkreuzt. Kein Geringerer als der Kanzler selbst gab die neue Marschrichtung vor. Nun soll es eine „Reform aus einem Guss“ geben, bei der auch die Finanzierungsvorschläge der Rürup-Kommission berücksichtigt werden. Ohne das beharrliche Eintreten der Ärzteschaft für eine saubere und dauerhaft gesicherte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung hätte die Politik vermutlich noch viel länger die Einsicht in die Notwendigkeit einer umfassenden Reform verweigert. Es bedurfte einer Vielzahl unterschiedlicher Anstrengungen, von politischen Gesprächen über „Brandbriefe“ bis hin zu medienwirksamen Aktionen, um die Behauptung zu korrigieren, die vorhandenen finanziellen Ressourcen reichten für eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung aus. Zwar gibt es nach wie vor Krankenkassenfunktionäre und einige politische Mitstreiter, die trotz Jahrzehnte langer Kostendämpfungspolitik noch milliardenschwere Wirtschaftlichkeitsreserven in der Patientenversorgung vermuten, die es erst einmal zu heben gelte, bevor man „mehr Geld ins System“ pumpe. Doch wenn nicht alles täuscht, haben diese selbst ernannten Sparkommissare und Regierungsberater an Einfluss und Zustimmung verloren. Die Glaubwürdigkeit so mancher Kassenfunktionäre wurde im Berichtszeitraum auch dadurch nachhaltig erschüttert, dass die exorbitante Zunahme der Verwaltungskosten der Krankenkassen von bis zu 7 Prozent der Leistungsausgaben weitaus größere Effizienzreserven im eigenen Haus nahe legten. Alarmrufe finden Gehör: Ärztemangel wird zum MedienthemaEs war letztlich die Macht des Faktischen, die zu einer politischen Neubewertung der Lage im Gesundheitswesen führte. So war die lange für unumstößlich gehaltene Gewissheit, es gebe „Überkapazitäten“ in der ärztlichen Versorgung, plötzlich nichts mehr wert. Denn der sich abzeichnende und in Teilen Ostdeutschlands bereits sichtbare Ärztemangel war auch von den größten Ignoranten unter den Theoretikern der „Ärzteschwemme“ nicht länger zu leugnen. Das von den Expertokraten gezeichnete Bild der „Über-, Unter- und Fehlversorgung“ bekam erste deutliche Risse. Gerade die Vielzahl der Presse-Anfragen und Veröffentlichungen zum Thema Ärztemangel im Berichtszeitraum kann als Indiz für einen Umschwung in der öffentlichen Meinung gewertet werden. So schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ am 20.02.2003 in einem bemerkenswerten Kommentar: „Deutschland droht ein Ärztemangel. Viele Kliniken können ihre Stellen nicht mehr besetzen. In Ostdeutschland fehlten im vergangenen Jahr in 237 Krankenhäusern 1051 Ärzte, Abteilungen mussten geschlossen werden. Praxen auf dem Land machen zu, weil sie niemand übernehmen will. Manche Fachmediziner gehören zu einer aussterbenden Gattung, Kinderärzte zum Beispiel. Einige Kinderkliniken schließen bereits – eine gefährliche Entwicklung, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen ihre eigene Medizin. All das ist kein plötzlicher Wandel, er hat schleichend begonnen. Doch selbst Alarmrufe wie 2002 auf dem Ärztetag in Rostock werden ignoriert oder gar als Lüge bezeichnet.“ Und auch die Tageszeitung „Die Welt“ (02.06.2002) konstatierte unter der Überschrift „Dem Osten laufen die Ärzte weg“ eine zunehmende Unterversorgung mit Ärzten in den neuen Bundesländern: „Ob in Sachsen oder Brandenburg – überall in Ostdeutschland mangelt es an Ärzten. Schon jetzt stehen mehrere hundert Praxen leer, 450 Klinikärzte werden gesucht. Doch es wird noch schlimmer kommen. Denn bis zu 40 Prozent der Kassenärzte in den neuen Ländern werden in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen. ‚Wenn es nicht schnell eine konzertierte Aktion von Politik, Kassen und Verbänden gibt, droht ein Versorgungsnotstand', warnt Jan Schulze, Präsident der sächsischen Ärztekammer“. In den Medien, vor allem in den ostdeutschen Tageszeitungen, ist der drohende oder bereits existierende Ärztemangel zum einem immer wiederkehrenden Thema in der Berichterstattung geworden. Selbst das Bundesgesundheitsministerium (BMG) konnte das Problem nicht mehr ignorieren. In ihrer Rede zur Eröffnung des 51. Deutschen Ärztekongresses am 17. Juni 2002 erklärte Ministerin Schmidt: „Bei meinen vielfältigen Besuchen vor Ort sehe ich, wie schwer es für Krankenhäuser geworden ist, ärztlichen Nachwuchs zu gewinnen und zu halten. Das liegt nicht an sinkenden Zahlen von Studienanfängerinnen und -anfängern, sondern teilweise am Studienverlauf selber oder daran, dass junge Menschen nach dem Studium aussteigen. Die Vergütung der Ärztinnen und Ärzte im Praktikum ist nicht lukrativ und die Arbeits- und Arbeitszeitbedingungen in vielen Kliniken nicht akzeptabel.“ In der rot-grünen Koalitionsvereinbarung vom 16. Oktober 2002 versprach die Regierung gar, dem sichtbaren Mangel entgegen zu wirken: „Der Bund wird seinen Beitrag leisten, damit regionale Defizite an Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal ausgeglichen und unzumutbare Belastungen in Kliniken, Praxen und Pflegediensten vermieden werden.“ Zwar wurden diese Absichten durch die später beschlossene Nullrunde für Ärzte und Krankenhäuser ins Gegenteil verkehrt, aber die Regierung konnte nun an ihren eigenen Worten gemessen werden. Das Thema Ärztemangel blieb auf der gesundheitspolitischen Agenda – dank der konsequenten, mit Daten und Fakten belegten Vermittlung dieses Themas durch die Bundesärztekammer. Gleiches war zuletzt mit dem 104. Deutschen Ärztetag 2001 in Ludwigshafen gelungen, als die Ärzteschaft die Ausbeutung junger Ärztinnen und Ärzte anprangerte. Die Warnung vor Versorgungsengpässen und die Kritik an der zunehmenden Durchökonomisierung des Gesundheitswesens zu Lasten der Patienten, wie sie in den Stellungnahmen der Bundesärztekammer und des „Bündnis Gesundheit 2000“ zum Ausdruck kamen, wurden nun nicht länger mehr als „Panikmache“ abgetan. Im Gegenteil, das Plädoyer für eine zuwendungsorientierte Medizin und die Absage an eine staatliche Zuteilungsmedizin nach englischem Muster erhielt breiten publizistischen Rückhalt, auch und gerade bei den ‚Meinungsmachern' unter den Tageszeitungen. Die Konfrontation: Kampf gegen staatliche Bevormundung und fixe IdeenWie kaum eine andere Idee verkörpert das „Institut für Qualität in der Medizin“ die Zuteilungsphilosophie der staatsmedizinischen Vordenker. In einem von der SPD in Auftrag gegebenen Gutachten forderten einige der Partei nahe stehende Gesundheitsökonomen bereits im Dezember 2001 die Schaffung eines solchen Instituts. Anfang April 2002 fand sich diese Forderung schließlich auch in den ersten Entwürfen eines SPD-Wahlprogramms. In einem Papier für den „Arbeitskreis Arbeit und Soziales“ der Friedrich-Ebert-Stiftung machten SPD-nahe Gesundheitsökonomen deutlich, dass dem neuen „Institut für Qualität in der Medizin“ eine Schlüsselstellung innerhalb des Gesundheitssystems zukomme. Nach den Vorstellungen der Experten sollte das „staatliche Institut für Qualität in der Medizin ... auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse die Qualitätsstandards für den Wettbewerb im Gesundheitswesen definieren“. Zu diesen Standards sollten zum Beispiel Mindestmengen oder Leitlinien für wichtige medizinische Eingriffe gehören. „Spätestens nach einer Übergangszeit müssen Einrichtungen, die diesen Qualitätsstandards nicht genügen, von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden“, forderten die SPD-Berater. Wie ein roter Faden durchzog die Idee des Staatsinstituts von nun an alle programmatischen Aussagen der Regierungspartei. Das Institut geriet zum Fixpunkt einer primär ökonomisch ausgerichteten Listenmedizin, der die individuellen Bedürfnisse der Patienten untergeordnet werden sollten. Dieses mehr oder minder deutliche Bekenntnis zur staatlichen Steuerung des Gesundheitswesens alarmierte die Bundesärztekammer. In einem Brandbrief an Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt warnte Bundesärztekammer-Präsident Hoppe am 4. April 2002 davor, die Ärzte „als technokratische Erfüllungsgehilfen einer dogmatisierten Leitlinienmedizin degradieren und die Patienten zu einer Norm- und Kostengröße reduzieren zu wollen“. Unter der Überschrift „Auf dem Weg in englische Verhältnisse –Zukunftsperspektiven deutscher Gesundheitspolitik?“ legte Hoppe der Ministerin die aus seiner Sicht unverzichtbaren Grundlagen einer bedarfsgerechten Versorgung in sieben Thesen dar. Der Patient habe Anspruch auf eine individuelle, nach seinen Bedürfnissen ausgerichtete Behandlung und Betreuung, schrieb der BÄK-Präsident. Das setze aber Therapiefreiheit des Arztes ebenso voraus wie die Bereitstellung der notwendigen Mittel. „Eine Rationierung medizinischer Leistungen oder auch der Weg in die Checklistenmedizin führen in die Unterversorgung“, warnte Hoppe. Die Gesundheitsversorgung Deutschlands drohe in einen Versorgungsnotstand zu geraten. Schon jetzt zeichneten sich akute Nachwuchsprobleme in der Ärzteschaft wie auch bei den Pflegeberufen ab. Trotzdem werde Gesundheitspolitik vorwiegend als Kostendämpfungspolitik betrieben. Daran hätte auch die Diskussion über die dramatischen Versorgungsengpässe in staatlichen Gesundheitssystemen wie dem englischen nichts ändern können. „Im Gegenteil: Die verantwortlichen Politiker lassen sich von parlamentarisch nicht legitimierten Expertokraten den Weg in die staatliche Reglementierung der Gesundheitsberufe und in die gnadenlose Durchökonomisierung der Krankenversicherung weisen. Nicht mehr der Patient steht im Mittelpunkt der Betrachtung; Gesundheitspolitik droht zum Selbstzweck zu verkommen“, kritisierte der BÄK-Präsident die Konzepte der Regierungsberater. „Ärztepräsident warnt vor englischen Verhältnissen“ titelte am darauf folgenden Tag die Tageszeitung „Die Welt“ und die „Berliner Zeitung“ (05.04.2002) schlagzeilte:„Ärzteschaft warnt vor massiven Personal-Engpässen“. Vor allem das Szenario eines „Versorgungsnotstands“ im Gesundheitswesen fand Eingang in die Berichterstattung der Tagespresse. Damit erschienen auch die Thesen der SPD-nahen Gesundheitsökonomen, die in ihrem Gutachten unter anderem eine Übertragung des Sicherstellungsauftrages für die ambulante ärztliche Versorgung an die Krankenkassen und die Aufhebung des Kontrahierungszwangs gefordert hatten, in einem anderen Licht. Der Kontrast zwischen den Positionen der SPD-nahen Experten und denen der Bundesärztekammer war jedenfalls augenfällig und trat in mehreren Artikeln auch offen zu Tage. So stellte die „Rheinische Post“ (05.04.2002) in ihrem Kommentar die Frage „Welche Maßstäbe gedenken Bürokraten anzulegen, wenn es um die Bewertung ärztlicher und klinischer Leistungen geht? Die Errichtung weiterer Überwachungsinstitutionen löst jedenfalls keines der strukturellen Probleme.“ Der SPD riet der Kommentator der „Rheinischen Post“, „jene Vorschläge, die ihr von parteinahen Experten zur Gesundheitsreform angedient wurden, in der Versenkung verschwinden zu lassen“. Nur wenige Tage später stellte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in einer Rede vor der Friedrich-Ebert-Stiftung die Leitlinien sozialdemokratischer Gesundheitspolitik der Öffentlichkeit vor. Gleich zu Beginn ihrer Rede sah sie sich gezwungen, in einem Punkt auf Distanz zu dem seit Tagen heftig diskutierten Experten-Papier für die Friedrich-Ebert-Stiftung zu gehen. Die populäre Forderung nach Zerschlagung der Monopole oder gar des gesamten Gesundheitssystems sei für sie keine Lösung. Zugleich aber unterstützte sie die Forderung der Experten nach einem Qualitätsinstitut. Die Frage der Bewertung der Qualität solle von der Frage der Finanzierung getrennt werden. Über Behandlungsleitlinien müssten die „unabhängigen Sachverständigen“ des Instituts entscheiden. Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen würde dann von diesem „Zentrum für Qualität in der Medizin“ die notwendigen Grundlagen erhalten, um über die Fortschreibung des Leistungskatalogs entscheiden zu können. Auch müssten die Kassen die Freiheit haben, Einzelverträge mit Leistungsanbietern abzuschließen, die ein festgelegtes Qualitätsniveau garantierten. Staatliche Kontrolle der Leistungsanbieter und Einkaufsmodelle zur „Stärkung des Wettbewerbs der Krankenkassen“ – so sah das Programm der Ministerin aus. Gegen diesen „Paradigmenwechsel“ im Gesundheitswesen machte die Ärzteschaft nun verstärkt Front. Der Präsident der Bundesärztekammer brachte die gegensätzlichen Positionen in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“ (09.04.2002) auf den Punkt: „Wir wechseln von einem sehr freien Gesundheitswesen in ein staatliches Gesundheitswesen“, warnte Hoppe. Zugleich wandte er sich gegen das mechanistische Weltbild, das der Staatsmedizin zugrunde liege: „Die Medizin ist keine exakte Naturwissenschaft, sondern sehr individuell. Ärztliche Betreuung darf keine Checklistenmedizin sein.“ Die offen artikulierten Vorstellungen des BMG riefen nun auch die Heilberufe gemeinsam auf den Plan. Zusammen mit der Bundeszahnärztekammer und der Bundesapothekerkammer präsentierte die Bundesärztekammer am 16. April 2002 vor der Bundes-Pressekonferenz in Berlin ein Sieben-Punkte-Programm zur Reform des Gesundheitswesens. In den Medien wurde diese Intervention als „Gegenkurs zur rot-grünen Regierung“ (Deutsche Presse-Agentur) und Forderung nach einer „Kehrtwende der Gesundheitspolitik“ („Die Welt“) verstanden. Besonders gewürdigt wurde, dass sich Ärzte, Zahnärzte und Apotheker „erstmals in rund 30 Jahren Kostendämpfungspolitik“ („Handelsblatt“) auf Eckpunkte für eine Gesundheitsreform verständigen konnten. „Fünf Monate vor der Bundestagswahl gehen Ärzte und Apotheker auf einen scharfen Konfrontationskurs zur Gesundheitspolitik der rot-grünen Bundesregierung. Der werfen sie vor, die Selbstverwaltung aus Ärzten und Krankenkassen zugunsten staatlicher Bevormundung schwächen zu wollen“, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (17.04.2002). Vor dem Hintergrund zahlreicher Vorschläge für Veränderungen des deutschen Gesundheitswesens warnte BÄK-Präsident Hoppe davor, das „System kaputt zu reden“. Bei fairer Betrachtung müssten selbst schärfste Kritiker einräumen, dass „es höchstens eine Hand voll Länder gibt, die einen ähnlich hohen Qualitätsstandard in der medizinischen Versorgung bieten wie Deutschland“, zitierte die „Berliner Zeitung“ (21.05.2002) aus seiner Rede zum Hauptstadtkongress „Medizin und Gesundheit“. Hoppe betonte, dass sich die Ärztinnen und Ärzte bei der für den 1. Juli 2002 geplanten Einführung der Disease Management-Programme (DMP) nicht als staatliche Erfüllungsgehilfen sähen. „Patienten sind keine Kunden, sondern Bedürftige“, sagte Hoppe. Kaltes betriebswirtschaftliches Denken habe in einem Gesundheitswesen der Menschlichkeit nichts zu suchen. DMP: Medizin als TagesgeschäftDie Bundesärztekammer verwahrte sich gegen die nunmehr unübersehbaren Versuche des Bundesgesundheitsministeriums, die finanziellen Defizite der gesetzlichen Krankenversicherung in Qualitätsdefizite der Leistungserbringer umzudeuten. Mit Blick auf den Termin der Bundestagswahl am 22. September 2002 ließen Ministerin Schmidt und ihr Chefberater Lauterbach kaum eine Gelegenheit aus, die vermeintliche „Über-, Unter- und Fehlversorgung“ in Deutschland zu beklagen. Die bereits Mitte 2001 angezettelte Debatte um angeblich „mittelmäßige“ und „zu teure“ Leistungen bekam dadurch neuen Auftrieb. Zwar hielt die Behauptung, Deutschland stehe trotz hoher Gesundheitsausgaben international vergleichsweise schlecht da, keiner wissenschaftlichen Prüfung stand, doch darum ging es ohnehin nicht mehr. Echte Expertise und informativer Austausch mit den Beteiligten und Betroffenen waren nicht gefragt. Es ging für das BMG um die Frage, wie man eine unterfinanzierte und dadurch sukzessive schlechter werdende Versorgung trotzdem als politisch verwertbaren Erfolg verkaufen konnte. Das Paradoxon wurde in den schwer verständlichen, aber sehr professionell klingenden Namen „Disease Management-Programm“ gekleidet und sollte unbedingt zur persönlichen Erfolgsstory der Ministerin werden. Denn mit diesem Instrument ließen sich nach den immer wieder geäußerten Vorstellungen des BMG gleich mehrere Probleme auf einmal lösen: Die „Über-, Fehl- und Unterversorgung“ chronisch Kranker würde beendet; der Wettbewerb um gesunde Versicherte zu Lasten der „großen Versorgerkassen“ könnte durch die Kopplung der Programme an den Risikostrukturausgleich wieder in geregelten Bahnen verlaufen; der Verschwendung von Versichertengeldern durch unbotmäßige Normalversorgung würde ein Riegel vorgeschoben. Letzteres war ein Standardargument der Ministerin: Gleichgültig um was es sich handelte – DMP, Fallpauschalen oder elektronische Gesundheitskarte – , Einsparmöglichkeiten schien es überall zu geben. Der Beitrag zahlende Wähler sollte jedenfalls wissen, so das Kalkül, wem er das beharrliche Aufspüren milliardenschwerer „Effizienzreserven“ zu verdanken hatte. Das Kalkül konnte aber nur dann aufgehen, wenn die vermeintlichen Fortschritte auch sichtbar gemacht würden. Daher sollte nichts unversucht bleiben, um wenigstens eines der Disease Management-Programme vor den Wahlen am 22. September in Form eines unterschriftsreifen Vertrages präsentieren zu können. Schon Ende März 2002 drohte die Ministerin mit einer „staatlichen Ersatzvornahme“ für den Fall, dass die Selbstverwaltungspartner im Koordinierungsausschuss keine Einigung über die inhaltliche Ausgestaltung der Programme erzielen würden. Dagegen erhob sich vehementer Protest:„Wir lassen uns nicht unter Druck setzen und werden auch eine staatlich verordnete Checklistenmedizin nicht akzeptieren“, stellte BÄK-Präsident Hoppe in einer Pressemitteilung unmissverständlich klar. Die Bundesärztekammer habe immer wieder deutlich gemacht, dass solche strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke hohen Qualitätsstandards genügen müssten. „Notwendig ist eine behutsame Sacharbeit zur Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien, um tatsächlich eine bessere Behandlung von chronisch Kranken zu ermöglichen. Hektik und staatsdirigistischer Aktionismus sind hier völlig fehl am Platze“, kritisierte Hoppe. Wenn die Ministerin die Programme ohne verlässliche Grundlage allein aus politischen Gründen zum 1. Juli 2002 durchpeitschen wolle, erzwinge sie den Weg in die staatliche Zuteilungsmedizin. „Wir lassen uns auch nicht von der Androhung beeindrucken, dass die Behandlungsleitlinien notfalls über der Medizin völlig entfremdete Institute politiknaher Berater erstellt werden sollen – Medizin ist eben kein Tagesgeschäft“, warnte der BÄK-Präsident. Ähnlich kritisch beurteilte das Magazin „Focus“ (03.06.2002) das Vorgehen der Ministerin: „Das einzig verbliebene Vorzeigeprojekt der Gesundheitsministerin entpuppt sich vier Monate vor der Bundestagswahl als Riesenflop. (...) Aktionismus vor Qualität scheint die Devise von Schmidt, mit der sie die Diabetes-Programme vor der Wahl noch durchpauken will. Ein riskanter Schnellschuss.“ Obwohl mit den Programmen Millionen Euro von den Krankenkassen mit vielen gesunden Versicherten zu jenen mit vielen Chronikern verschoben würden, fehlten bisher sämtliche Prüfvorschriften. „Die Kopplung der Programme an das Geld sei eine ‚unheilvolle Verquickung', warnt der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe“, hieß es im Bericht des „Focus“. Die medizinisch widersinnige Verquickung von Wettbewerb, Finanzausgleich und DMP müsse aufgehoben werden, forderte Hoppe im Interview mit dem „Forum für Gesundheitspolitik“ (09/2002). Den Kassen gehe es darum, möglichst viele Patienten für die Programme zu gewinnen, um ein großes Stück vom gemeinsamen Kuchen Finanzausgleich zu bekommen. Zugleich aber sollten die Programme aus Sicht der Kassen keine höheren Kosten verursachen, denn das würde die ökonomischen Ziele sonst konterkarieren. „Gefragt ist also der ‚gesunde Chroniker', der gerade eben die Einschreibe-Kriterien der Programme erfüllt, ohne nennenswerte Leistungen in Anspruch zu nehmen“, sagte der BÄK-Präsident. Unterdessen legten die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen ihren Streit um die Frage bei, welche Patienten- und Behandlungsdaten die Kassen für die DMP erhalten sollen. Der Kompromiss sah vor, dass die Ärzte die Behandlungsdaten an eine von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen neu zu gründende Gesellschaft übertragen, die den Kassen nur Datenmaterial mit Pseudonymen zur Verfügung stellt. Damit war allerdings nur eine der Voraussetzungen für ein In-Kraft-Treten der Behandlungsprogramme erfüllt. Über die weitaus schwierigere Frage der Anforderungsprofile für die DMP Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs wurde im Koordinierungsausschuss noch heftig gerungen. Unter dem Druck der angedrohten Ersatzvornahme durch das BMG kam es schließlich zu einem Beschluss, der den kleinsten gemeinsamen Nenner der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen definierte. Die Gefahr einer Versorgung nach unzureichenden Mindeststandards war damit aber keineswegs gebannt. Als die 4. Änderungsverordnung zur Risikostruktur-Ausgleichsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums am 1. Juli 2002 in Kraft trat, waren zwar die formalen Voraussetzungen für den Start der Programme erfüllt, doch die Skepsis der Ärzte war unüberhörbar. „Die medizinischen Inhalte der Disease-Mangament-Programme sind im Schweinsgalopp festgelegt worden und entsprechen bei weitem nicht immer dem heute bereits erreichten Standard“, sagte BÄK-Präsident Hoppe. Dieser immer wieder von der Ärzteschaft kritisierte enorme Druck im Verfahren mache sich selbstredend an der Qualität der Programme und damit auch an der Akzeptanz unter den Ärzten und Ärztekammern bemerkbar. Als grundsätzlicher Webfehler der geplanten DMP musste die Festlegung auf Mindeststandards gesehen werden. Daran entzündete sich der Hauptwiderstand der Ärzteschaft: „Wir wollen verhindern, dass aus Mindeststandards Minderstandards werden. Davor müssen wir die Patienten schützen“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer in einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ (16.09.2002). Das Unbehagen der Ärzte war größer, als die Politik es wahrhaben wollte. Deshalb erwies sich auch die vollmundige Prophezeiung der Ministerin, im Laufe des Jahres würden noch Empfehlungen des Koordinierungsausschusses für DMP zu koronaren Herzkrankheiten und chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen folgen, als außerordentlich realitätsfremd. Der Koordinierungsausschuss ließ jedenfalls keinen Zweifel daran, dass man sich nicht wieder unter Zeitdruck setzen lassen werde. Besondere Unterstützung in seiner Arbeit erfuhr der Koordinierungsausschuss derweil durch das „Nationale Programm für Versorgungs- Leitlinien bei der Bundesärztekammer“ (NPL). Damit sollten die inhaltlichen Grundlagen für strukturierte Behandlungsprogramme unter Berücksichtigung der Kriterien der evidenzbasierten Medizin geschaffen werden. Mit dem NPL untermauerte die Ärzteschaft aber auch ihre grundsätzliche Bereitschaft, die Implementierung abgestimmter Schlüsselempfehlungen deutscher Leitlinien für die Entwicklung von Disease Management-Programmen voran zu bringen. Je näher der Wahltermin am 22. September aber rückte, umso heftiger wurde über die Qualität der Programme gestritten. Schließlich ging es um ein Markenzeichen sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Kontroverse, als der Länderausschuss der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die KVen Anfang September aufforderte, mit Blick auf das bevorstehende Ergebnis der Bundestagswahl vorerst keine DMP-Verträge mit den Krankenkassen abzuschließen. Daraufhin schaltete sich eine Woche vor den Wahlen sogar der Bundeskanzler in die Debatte ein. Er warf der KBV vor, sie mische sich als „Lobby der Oppositionsparteien in den Wahlkampf“ ein und torpediere aus egoistischen Interessen eine bessere Behandlung von Brustkrebspatientinnen. Dies sei „zynisch und wohl kaum mit ärztlichem Eid und Selbstverständnis vereinbar“. Die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Kassenärzten hatte damit aber noch nicht ihren Höhepunkt erreicht: Unmittelbar vor den Wahlen schalteten 19 Kassenärztliche Vereinigungen Anzeigen in der Tagespresse, um die Wähler von der Notwendigkeit eines Politikwechsels zu überzeugen. Der Intervention mitten in der heißesten Phase des Wahlkampfs blieb ein Erfolg aber versagt. Rot-Grün wurde – wenn auch knapp – im Amt bestätigt. DRG-Einführung: „Würfelspiel auf falscher Grundlage“Unmittelbar vor der Wahl hatte das Bundesgesundheitsministerium bei einem weiteren Großprojekt vollendete Tatsachen geschaffen. Per Rechtsverordnung wurde die Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen im Rahmen eines Optionsmodells ab 1. Januar 2003 zur beschlossenen Sache erklärt. Die verbindliche Einführung des neuen Vergütungssystems war nach langem Hin und Her zwischen Bundestag und Bundesrat im Fallpauschalengesetz auf den 1. Januar 2004 festgelegt worden. Dabei war nicht nur den mit der Materie vertrauten Experten längst klar, dass der Zeitplan zur Einführung der von Australien übernommenen Diagnosis Related Groups (DRGs) im krassen Gegensatz zu den Versorgungsrealitäten in den Krankenhäusern stand. Deshalb versuchten Ärzteschaft, Krankenkassen – mit Ausnahme der AOK – und Pflegeverbände in einer bis dahin nicht gekannten Geschlossenheit, verlässliche Rahmenbedingungen zu erreichen. In einer auf maßgebliche Initiative der Bundesärztekammer zustande gekommenen gemeinsamen Presse-Erklärung (09.09.2002) kritisierten sie die Unzulänglichkeiten der BMG-Rechtsverordnung. Es sei unverantwortlich, wenn das Ministerium weiterhin Schönfärberei betreibe und an dem mit heißer Nadel gestrickten Optionsmodell festhalte. Die Einführung der DRGs gestalte sich so zu einem „Würfelspiel auf falscher Datengrundlage“. „Ärzte und Kassen rügen geplante Klinikreform“ titelte am Tag nach Veröffentlichung der Erklärung die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schrieb: „Die Spitzenverbände der Ärzte und Krankenkassen laufen Sturm gegen das neue Abrechnungssystem für Krankenhäuser“. „Nach wie vor ignoriert das Ministerium beharrlich die ... groben Mängel des Systems, wohl aus Gründen der politischen Opportunität“, hieß es in einer weiteren Pressemitteilung der Bundesärztekammer (12.09.2002). Auf einer Anhörung des BMG forderten Ärzteschaft und Krankenkassen unisono, das DRG-System im Jahr 2003 zunächst im Rahmen einer für die Krankenhäuser wie Krankenkassen kostenneutralen Simulation auf bundesdeutscher Datenbasis zu validieren und die vorhandenen groben Fehler zu bereinigen und erst danach zur Abrechnung einzusetzen. Die Bundesärztekammer kritisierte entschieden den viel zu engen Zeitplan, der eine verlässliche Kalkulation der neuen Fallpauschalen kaum möglich mache. Die hierfür notwendige Ermittlung von Kostengewichten könne verständlicherweise nur auf der Grundlage deutscher Kostenerhebungen geschehen. Die Regierungspläne sahen aber eine Verpflichtung der Krankenhäuser vor, ihre Bewertungen auf der Grundlage des australischen Ursprungssystems vorzunehmen, um den selbst gesetzten Zeitplan einzuhalten. „Unter diesen Voraussetzungen drohen nicht zu verantwortende Versorgungsdefizite und Innovationshemmnisse. Deshalb plädieren wir dafür, den Zeitplan zu entzerren“, äußerte sich BÄK-Präsident Hoppe. Mit dem vorgesehenen Optionsmodell sollten nicht die effizientesten Krankenhäuser belohnt werden, sondern zunächst die Kliniken, die den Übergang in das neue Vergütungssystem am schnellsten bewerkstelligten. „Die Versorgung der Patienten ist vor allem dann gefährdet, wenn das neue DRG-System ohne Rücksicht auf die durch das ärztliche und pflegerische Personal tatsächlich geleistete Arbeitszeit durchgesetzt wird“, kritisierte bereits Ende Mai der 105. Deutsche Ärztetag in Rostock das Vorgehen der Regierung. 105. Deutscher Ärztetag in RostockDer 105. Deutsche Ärztetag in Rostock war ein Medienereignis ersten Ranges. Bilder und Berichte von der Eröffnungsveranstaltung in der Warnemünder Werft waren in den Nachrichtensendungen des Fernsehens ebenso zu sehen wie in den Tageszeitungen und der Fachpresse. Allein die Zahl der akkreditierten Journalisten – es waren mehr als 110 – verdeutlicht das große Interesse der Medien an dem Rostocker Ärztetag. Das ist insofern bemerkenswert, als parallel zum Ärztetag der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin tagte, der gleichfalls sozialpolitisch interessierte Journalisten ansprach. Neben den Nachrichtenagenturen dpa, AP, ddp, Reuters, AFP, KNA und epd sowie bundesweit erscheinenden und lokalen Tageszeitungen berichteten zahlreiche Hörfunk- und Fernsehteams von der Eröffnungsveranstaltung des 105. Deutschen Ärztetages. Aktuelle Meldungen sowie Hintergrundinformationen zu den Themen des Ärztetages konnten auch über das Internet-Angebot der Bundesärztekammer abgerufen werden. Darüber hinaus wurde erneut der Originaltextservice der dpa-Tochter News aktuell genutzt, um die Pressemitteilungen der Bundesärztekammer bundesweit allen angeschlossenen Redaktionen in Deutschland sofort verfügbar zu machen. Entsprechend lückenlos war die Berichterstattung in den Medien. Eine sehr gute Medienresonanz erfuhr der Ärztetag aber nicht nur hinsichtlich der Breite der Berichterstattung. Auch die Kommentierung der Beschlüsse und Debatten auf dem Ärztetag verdiente das Prädikat „ausgesprochen wohlwollend“. So nahmen beispielsweise die Warnungen der Ärzteschaft vor einem drohenden Ärztemangel breiten Raum in der Presse Berichterstattung ein. Allein die „Süddeutsche Zeitung“ widmete dem Thema eine ganze Seite und auch die Medien – allen voran der Norddeutsche Rundfunk – griffen in ihren Beiträgen auf die Argumente der Ärzteschaft zurück. In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ (24.05.2002) hatte BÄK-Präsident Hoppe schon unmittelbar vor dem Ärztetag auf die „Nachwuchssorgen“ der Ärzteschaft hingewiesen: „Schlechte Bezahlung, viel Arbeit, wenig Freizeit – immer weniger junge Leute haben Lust, diese Maloche mitzumachen.“
Für die „Fernsehschiene“ der ARD wie auch für die „Sammelberichterstattung zum Hörfunk“ der ARD-Anstalten produzierte der NDR Live-Gespräche, Magazinbeiträge, Reportagen und Hintergrundberichte. Hinzu kamen Reporter anderer Hörfunksender, die ihre Rundfunkhäuser zusätzlich mit Berichten und vor allem Interviews belieferten. Neben den ARD-Anstalten berichteten auch das ZDF und private Fernsehsender wie SAT.1, n-tv und RTL vom Ärztetag. Hörfunk-Interviews mit Vorstandsmitgliedern der Bundesärztekammer sendeten neben dem NDR auch das Deutschlandradio Berlin, der Deutschlandfunk und der Westdeutsche Rundfunk. Außerdem gab es in den Pressekonferenzen am Mittwoch und Donnerstag Gelegenheit, die Themen des Vormittags nachzuarbeiten bzw. des Nachmittags vorzubereiten. Außer den Pressekonferenzen fand zum Abschluss eines jeden Tages ein bilanzierendes Pressegespräch in der Pressestelle des Ärztetages statt. Wahlkampf 2002: Schönwetterprognosen und fehlender MutAnders als vielfach erwartet war die Reform des Gesundheitswesens kein intensiv diskutiertes Thema im Wahlkampf. In der öffentlichen Diskussion konzentrierte sich das Interesse vorrangig auf die Beschäftigungskrise und die Diskussionen über Reformen auf dem Arbeitsmarkt. In den letzten Wochen des Wahlkampfs standen dann die verheerenden Hochwasser in Teilen Ostdeutschlands und die Irak-Frage im Vordergrund. Trotzdem versuchte die Bundesärztekammer, auf die Notwendigkeit einer wirklichen Strukturreform im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. In einem Offenen Brief an die Vorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien verlangte BÄK-Präsident Hoppe Ende August 2002 von den Parteien ein klares Bekenntnis zu mehr Solidarität und Menschlichkeit im Gesundheitswesen. Der Brief fand in der Presse ein breites Echo. So berichteten mehrere Tageszeitungen ausführlich über die dem Brief als Anlage beigefügten „Gesundheitspolitischen Positionen der Ärzteschaft“. Die „Frankfurter Rundschau“ titelte:„Ärzteschaft warnt vor Kollaps“. Hoppe hatte die Parteivorsitzenden aufgefordert, „den Schönwetter-Prognosen der Expertokraten im Gesundheitswesen eine klare Absage zu erteilen“. Spätestens jetzt sei es an der Zeit, die Struktur des Gesundheitswesens nicht länger kaputt zu reden, sondern die Einnahmebasis der Krankenkassen zu stabilisieren und endlich auch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. „Patienten haben Anspruch darauf, individuell und nach bestem Wissen und Gewissen behandelt zu werden, und das heißt nach dem jeweils möglichen Stand der medizinischen Wissenschaft, aber auch mit dem höchstmöglichen Maß an Zuwendung und Vertrauen. Eine gnadenlose Durchökonomisierung des Gesundheitswesens aber wird weder Ressourcen für den Notfall noch Zeit und Zuwendung für die Patienten zulassen. Ich bitte Sie deshalb, politisch darauf hinzuwirken, dass wir unserer Verantwortung für den Patienten gerecht werden können“, schrieb Hoppe an die Parteichefs. Hoppes Diktum, dass die meisten Probleme im Gesundheitswesen politisch erzeugt und zu verantworten seien, richtete sich gegen die parteiübergreifend betriebene „Verschiebebahnhofpolitik“ zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. „Die gesetzliche Krankenversicherung ist mehr und mehr sozialpolitische Manövriermasse und politischer Spielball geworden. Wo aber Versichertengelder zweckentfremdet werden, ist dann leichtfertig von „Kostenexplosion“ die Rede“, wurde Hoppe von der Nachrichtenagentur „Associated Press“ zitiert. Die von Hoppe genannte Größenordnung von 30 Milliarden Euro, die der GKV seit 1995 durch „Verschiebebahnhöfe“ entzogen wurden, fand in den folgenden Monaten an verschiedenen Stellen in den Medien immer wieder Erwähnung. Der BÄK-Präsident kritisierte den fehlenden Mut der Politik, die Herausforderungen im Gesundheitswesen anzugehen. Milliardendefizite, Personalmangel und inhumane Arbeitsbedingungen könnten nicht länger allein mit dem Engagement der Gesundheitsberufe kompensiert werden. Seinen Offenen Brief beschloss er mit einem Appell an die Parteivorsitzenden: „Zeigen Sie Problembewusstsein in der öffentlichen Diskussion und werben Sie mit uns gemeinsam für mehr Menschlichkeit im Gesundheitswesen.“ Regierung und Opposition blieben jedoch konkrete Antworten auf die Strukturkrise der gesetzlichen Krankenversicherung weitgehend schuldig und beließen es bei Absichtserklärungen und Allgemeinplätzen. So fand sich in allen Programmen das Bekenntnis zu „mehr Wettbewerb und Flexibilität“ und „stabilen Beiträgen“. Der Wettbewerb wurde zum Allheilmittel erkoren: er sollte die Qualität sichern helfen oder gar verbessern, die Finanzierbarkeit der Versorgung gewährleisten, die strukturellen Defizite im Gesundheitswesen beseitigen, die Wirtschaftlichkeit erhöhen und dem Gesundheitswesen insgesamt zu besserer Effizienz verhelfen. Dafür müssten nur das „starre Vertragssystem zwischen Kassen und Leistungserbringern“ (CDU/CSU) aufgebrochen werden, den Kassen das Recht eingeräumt werden, Verträge mit Leistungsanbietern zu schließen, „die ein festgelegtes Qualitätsniveau zu angemessenen Kosten“ garantieren“ (SPD) und eine „neue Balance zwischen Markt, Selbstverwaltung und Staat im Gesundheitswesen“ (Bündnis 90/Die Grünen) gefunden werden. Eine seltsame große Koalition hatte sich hier zusammengetan. Alle miteinander huldigten sie dem Wettbewerb, als könnten damit die Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung vollständig beseitigt werden. Keine Partei befasste sich ernsthaft mit den erodierenden Einnahmen der GKV und den finanziellen Herausforderungen einer Gesellschaft des langen Lebens. Zwar betonten alle Parteien, dass den Menschen „unabhängig von ihrem Einkommen oder einer eventuellen Behinderung oder Vorerkrankung“ (FDP) eine uneingeschränkte Teilhabe am medizinischen Fortschritt ermöglicht werden müsse, doch blieben sie – vermutlich aus Angst vor unangenehmen Wahrheiten – eine ehrliche Antwort darauf schuldig, wie der Fortschritt in Zukunft finanziert werden soll, ohne dass es zu der befürchteten Zwei-Klassen-Medizin kommt. Kaum war die Bundestagswahl vorbei, wandelte sich das Bild. Nun auf einmal wurde das Gesundheitswesen neben dem Arbeitsmarkt zum Top-Thema der nächsten vier Jahre erkoren. Vom „schwierigsten Reformvorhaben“ der Legislaturperiode war plötzlich die Rede, und manche Kommentatoren sahen in der Reform des Gesundheitswesens sogar eine kaum zu bewältigende Herkules-Aufgabe, für die in der Tat übermenschliche Kräfte vonnöten seien. So verwunderte es nicht, dass sogar eine neue „Hartz-Kommission“ gefordert wurde, diesmal für das Gesundheitswesen. Sie sollte wenige Monate später tatsächlich eingesetzt werden, hörte fortan aber auf den Namen „Rürup-Kommission“. Bündnis für mehr Menschlichkeit statt DurchökonomisierungKonstruktiv-kritisch begleitete das „Bündnis Gesundheit 2000“ die Entwicklung in der Gesundheitspolitik. Nach mehrmonatiger Schaffenspause meldete sich das Bündnis der 38 Verbände und Organisationen der Gesundheitsberufe im September 2002 mit einem neuen Positionspapier zurück, das auf dem Eckpunktepapier aus dem Jahr 2000 aufbaute. An dem Zustandekommen des „Positionspapiers der Gesundheitsberufe für ein patientengerechtes Gesundheitswesen“ war die Pressestelle der deutschen Ärzteschaft maßgeblich beteiligt. Bei den vorbereitenden Sitzungen der Planungsgruppe des Bündnisses übernahm die Pressestelle eine koordinierende Funktion und unterstützte den Abstimmungsprozess zwischen den Verbänden nach Kräften. So konnte das neue Positionspapier des Bündnisses am 12. September 2002 – neun Tage vor der Bundestagswahl – der Presse in Berlin vorgestellt werden. Das Bündnis plädierte für rasche Veränderungen der wirtschaftlichen und beruflichen Rahmenbedingungen der Beschäftigten, um wieder Zuwendung möglich zu machen, wo Zuteilung, also Rationierung, drohe. „Mehr Menschlichkeit statt Durchökonomisierung“ –so lautete die zentrale Forderung des Bündnisses. Das Positionspapier dokumentierte den Willen der Bündnisteilnehmer, gemeinsam mit Politik, Patienten und Krankenkassen die derzeitigen Probleme des Gesundheitswesens zu diskutieren und – wenn möglich – einvernehmlich zu lösen. Als Hauptproblem betrachtete das Bündnis die zunehmende „Durchökonomisierung“ des Gesundheitswesens vor dem Hintergrund einer immer stärker um sich greifenden Wettbewerbsdoktrin. Der Patient drohe anonymisiert, Behandlung und Betreuung typisiert zu werden. Die Gesundheitsberufe würden unter einen enormen Kosten- und Konkurrenzdruck gesetzt; Zuwendung drohe im Zuge von Effizienzsteigerungen und Rationalisierungen verloren zu gehen. „Die Berufe im Gesundheitswesen verlieren an Attraktivität, derweil die Zahl der Behandlungsbedürftigen stetig steigt. Die Gesundheitsversorgung gerät in Not“, hieß es in dem Papier. Ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen brauche eine stabile Finanzierungsgrundlage, um den wachsenden Bedarf an medizinischen und pflegerischen Leistungen decken zu können. Im krassen Gegensatz dazu stünden aber die fortgesetzte Auszehrung der gesetzlichen Krankenversicherung durch versicherungsfremde Leistungen und der politische Missbrauch zur Entlastung anderer Sozialversicherungszweige. Angesichts dieser Entwicklung werde dem GKV-Versicherten das Notwendige nicht mehr entsprechend dem medizinischen Fortschritt gewährleistet werden können. Das Bündnis appellierte deshalb dringend an die verantwortlichen Politiker wie an die Partner im Gesundheitswesen, „in ihrem Aktionismus inne zu halten und zu überlegen, was wirklich wichtig für eine gute Versorgung ist und wie dies solidarisch finanziert werden kann“. „Eine neue Debatte über die Finanzierung im Gesundheitswesen“ habe das Bündnis anstoßen wollen, berichtete „Associated Press“ (12.09.2002) unter der Überschrift „Verbände gegen Ökonomisierung der Gesundheitspolitik“. Besondere Erwähnung fand in der Tagespresse die Forderung des Bündnisses, den Verschiebebahnhof zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung zu beenden. Die von BÄK-Präsident Hoppe in der Pressekonferenz geäußerte Enttäuschung über die Wahlaussagen der Parteien war dem „Handelsblatt“ (13.09.2002) sogar eine Schlagzeile wert. Unter der Headline „Ärzte-Lobby: Keine Partei hat taugliche Konzepte für das Gesundheitswesen“ hieß es: „Als gestern das Bündnis Gesundheit seine Wahlprüfsteine vorlegte, holte Ärztekammerpräsident Hoppe vorsorglich zum Rundumschlag gegen alle Parteien aus. Keine von ihnen habe taugliche Konzepte für das Gesundheitswesen, stellte er fest und vermied jede Parteinahme für eine politische Couleur.“ Kundgebung am 12. November 2002: „Das Gesundheitswesen in Aufruhr“Kurz nach ihrer Wiederwahl erhob die rot-grüne Bundesregierung die Reform des Gesundheitswesens zum prioritären Vorhaben der nächsten zwei Jahre. Die nunmehr auch für die Rentenversicherung zuständige neue Bundessozialministerin Schmidt schien sich mit ihrer Ansicht durchgesetzt zu haben, dass die Reform in zwei aufeinander folgenden Schritten zu erfolgen habe: Zunächst gelte es, ließ die Ministerin unentwegt verkünden, die Strukturen so zu verändern, dass „mehr Qualität und mehr Wettbewerb“ möglich werde. Erst wenn dies zum Abschluss gebracht worden sei, könne über die Veränderungen der Finanzgrundlagen diskutiert werden. Bis dahin reichten aber die bereits im Wahlkampf angekündigte Anhebung der Versicherungspflichtgrenze und die Erschließung von Rationalisierungsreserven aus, um das unter einem Defizit von rund 2,4 Milliarden Euro leidende System zu stabilisieren. Folgerichtig hieß es in der am 16. Oktober 2002 beschlossenen rot-grünen Koalitionsvereinbarung: „Wir sorgen durch die Erhöhung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit für sichere Finanzgrundlagen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Erste Maßnahmen zur Beitragssatzstabilisierung werden wir kurzfristig ergreifen (Vorschaltgesetz).“ Das Vorschaltgesetz entpuppte sich keine zwei Wochen später als pures Spargesetz, das erhebliche Konsequenzen für die im Gesundheitswesen Beschäftigten und die Patienten befürchten ließ. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion der Ärzteschaft aus: „Die Regierung unternimmt alles, um Arbeitsplätze im Gesundheitswesen zu vernichten. Das widerspricht nicht nur den selbstgesteckten Zielen in der Koalitionsvereinbarung, für mehr Beschäftigung zu sorgen. Die Koalition gefährdet mit ihren konfusen Sparbemühungen auch massiv die Versorgung der Patientinnen und Patienten“, kritisierte die Bundesärztekammer in einer Pressemitteilung. Zu befürchten sei ein großes Praxensterben und auch in den Krankenhäusern werde die Personalschraube weiter heruntergedreht werden. Diese Politik des Ausverkaufs führe zur völligen Demotivation der Berufe im Gesundheitswesen, eine humane Patientenversorgung auf dem heutigen Niveau werde unmöglich gemacht. „Wenn das kommt, werden sich massive Versorgungsengpässe nicht vermeiden lassen“, so BÄK-Präsident Hoppe gegenüber der „Financial Times Deutschland“ (31.10.2002). In einem Interview mit der Nachrichtenagentur ddp bezeichnete Hoppe die angekündigte Nullrunde für Ärzte und Krankenhäuser im Jahr 2003 als „Schlag in die Magengrube“. Zugleich kündigte er in weiteren Interviews mit Tageszeitungen sowie Hörfunk- und Fernsehsendern Proteste der Leistungserbringer im Gesundheitswesen an. Die Kommentatorin der „Süddeutschen Zeitung“ (04.11.2002) gab Hoppe ausdrücklich Recht, wenn er darauf dränge, so schnell wie möglich eine Reform auf den Weg zu bringen, „die das marode System endlich stabilisiert“. Weiter hieß es: „Der Protest der Ärzte gegen die Nullrunde ist heftig; der verärgerte Kanzler verliert die Contenance und schürt Sozialneid, das Ärzteeinkommen liege ‚nicht nur wenig über dem Sozialhilfeniveau'. So heizt Schröder die Situation unnötig an und ist zudem nicht auf der Höhe der Diskussion: Sicher, viele Ärzte können eine Nullrunde gut ertragen, ebenso vielen aber geht es schlecht. Im Osten herrscht bereits Ärztemangel, Westdeutschland steuert darauf zu.“ Wie groß der Unmut über die geplante Nullrunde war, wurde schon wenige Tage später sichtbar. In einer konzertierten Aktion zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem „Bündnis Gesundheit 2000“ gelang es innerhalb kürzester Zeit, eine Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor in Sicht- und Hörweite des Bundestages und des Bundeskanzleramtes zu organisieren. Rund 15.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen folgten am 12. November 2002 in Berlin dem Aufruf der Initiatoren, für „mehr Menschlichkeit statt Durchökonomisierung“ zu demonstrieren. Unmittelbar nach einer Anhörung des Bundestages über das geplante Beitragssatzsicherungsgesetz geißelten Ärzte, Apotheker, Arzthelferinnen, Krankenschwestern und Angehörige anderer Gesundheitsberufe die geplante Sparmaßnahmen als konzeptionslose, beschäftigungs- und patientenfeindliche Kostendämpfungspolitik. In einer gemeinsam verabschiedeten Resolution forderten das „Bündnis Gesundheit 2000“ und die DKG Bundeskanzler Gerhard Schröder auf, das Gesetz zurückzuziehen. „Die Jobmaschine Gesundheitswesen wird abgewürgt, wenn die Vergütung von Apotheken, Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern drastisch reduziert wird“, heißt es darin. Die „Flucht aus den Gesundheitsberufen“ werde weiter zunehmen, die Qualität der Versorgung steht auf der Kippe. Die Demonstration am 12. November war ein Großereignis in zweierlei Hinsicht: zahlenmäßig, was die unerwartet hohe Zahl der Teilnehmer anbelangt, und medial, wie sich an den vielen Berichten in Presse, Funk und Fernsehen ablesen ließ. Das beachtliche Medienecho zeigte, dass die Kundgebung eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht hatte: Die breite Öffentlichkeit war sensibilisiert und der Protest in die aktuelle politische Debatte getragen worden. Zudem wurde die Kundgebung in den Medien und der Öffentlichkeit weniger als Protest der Lobbyisten denn als Protest aller Beschäftigten im Gesundheitswesen wahrgenommen. „Gesundheitswesen in Aufruhr“ überschrieb die Nachrichtenagentur „Associated Press“ ihren Korrespondentenbericht. In ihren Headlines zitierten die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („Ullas Zeiten – Schlechte Zeiten“) und die „Westdeutsche Zeitung“ („Frau Schmidt, Sie wissen nicht, was Sie tun“) Spruchbänder der Demonstranten. Die Kundgebung war das Top-Thema des Tages und der ARD-Tagesschau“ sogar der Aufmacher wert. Auf den Titelseiten aller großen Tageszeitungen fanden sich am Tag danach Bilder und Berichte über die Demonstration der Gesundheitsberufe. Ausführlich schilderte der Korrespondent der „Westdeutschen Zeitung“ (13.11.2002) seine Eindrücke vom Ort des Geschehens: „Aus ganz Deutschland waren die Betroffenen an die Spree gereist, um mit Trillerpfeifen und Transparenten der rot-grünen Regierung und vor allem der ungeliebten Gesundheitsministerin Ulla Schmidt einzuheizen. ‚Frau Schmidt, es reicht' oder ‚Denn Sie wissen nicht, was Sie tun' waren die Parolen. Das Beitrags-Sicherungsgesetz der Ministerin, das Nullrunden im Gesundheitsbereich und massive Einschnitte für Apotheker sowie den Pharma-Bereich vorsieht, bringt die ganze Branche auf die Barrikaden.“ Nicht nur die Beschäftigten wendeten sich gegen die als „Nullrunde“ getarnte Minusrunde für das Gesundheitswesen. Auch das wichtigste Beratergremium der Bundesregierung, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kritisierte die Spargesetze als „Adhoc-Maßnahmen“, die „überwiegend dirigistischer Natur“ seien. Gleichwohl unterstützte der Rat einige der Reformvorstellungen des BMGS, wie z.B. die Stärkung wettbewerblicher Elemente bei der Vertragsgestaltung zwischen Krankenkassen und Ärzten. Die finanziellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung seien allerdings mit „Herumdoktern an Symptomen“ nicht zu lösen, schrieben die Fünf Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten 2002/03. Eine Lösung dieser Probleme sollte nun die „Kommission zur nachhaltigen Finanzierung der Sozialversicherungssysteme“ in Angriff nehmen, deren Leitung einem der Fünf Wirtschaftsweisen, dem Darmstädter Finanzwissenschaftler und Rentenexperten Prof. Dr. Dr. Bert Rürup, übertragen wurde. Die Einberufung einer solchen Kommission hatte die Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Das Tempo aber, mit dem die Rürup-Kommission nun ihre Arbeit aufnahm, deutete eine veränderte Prioritätensetzung an. Die Strategie der Ministerin, grundlegende Finanzierungsfragen hintan zu stellen und lediglich Ausgaben und Vertragsstrukturen zum Gegenstand der für 2003 angekündigten Gesundheitsreform zu machen, war gescheitert. Bundeskanzler Schröder ließ in der Folge keinen Zweifel daran, dass er Finanzierung und Ausgaben als zwei Seiten einer Medaille betrachtete, die einer gemeinsamen Lösung sprich Reform bedürften. Der Rürup-Kommission kam nun die Aufgabe zu, die Finanzierung der Sozialversicherung unter Wahrung der Generationengerechtigkeit langfristig zu sichern. Darüber hinaus soll die Kommission Vorschläge entwickeln, wie zukünftig die immer stärker werdende Bedeutung der Prävention zur Vorbeugung gegen Krankheiten sowie auch zur finanziellen Stabilisierung des Systems genutzt werden kann. Auch „die internationalen Diskussionen und Erfahrungen, insbesondere in der Europäischen Union, sind einzubeziehen“, so der Regierungsauftrag an die Kommission.
Trotz der massiven Proteste der Beschäftigten und der Kritik von Fachleuten, wie etwa den Fünf Wirtschaftsweisen, wurde das Beitragssatzsicherungsgesetz in beispielloser Eile über die parlamentarischen Hürden gebracht. Gegen das Veto der unionsgeführten Länder im Bundesrat setzte sich die rot-grüne Koalition mit der erforderlichen Kanzlermehrheit gegen die Opposition im Bundestag durch. Das Sparpaket mit einem geschätzten Volumen von 3,5 Milliarden Euro konnte nun am 1. Januar 2003 in Kraft treten. Wer geglaubt hatte, die Proteste der Gesundheitsberufe würden erlahmen, musste sich eines Besseren belehren lassen. Bereits vor Verabschiedung des Gesetzes hatte die Bundesärztekammer mit einem Boykott der Bürokratie im Gesundheitswesen gedroht, falls die Probleme des Systems weiterhin auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen würden. „Wir werden nicht die Patienten-Versorgung lahm legen“, sagte BÄK-Präsident Hoppe im Interview mit der „Financial Times Deutschland“ (11.12.2002). Als Reaktion auf die bevorstehende Honorar-Nullrunde würden die Ärzte aber weniger bürokratische Aufgaben erledigen und so den „Datenfluss empfindlich stören“. „Es geht darum, dass wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und uns mehr Zeit dafür nehmen, uns intensiv um unsere Patienten zu kümmern“, so Hoppe gegenüber der „FTD“. Die im „Bündnis Gesundheit 2000“ zusammengeschlossenen Gesundheitsberufe setzten bei ihren Protesten nunmehr auf konzertierte Aktionen in den Regionen. Dabei ging es nicht um einen „Dienst nach Vorschrift“, wie ihn die Kassenärztliche Bundesvereinigung plante, und auch nicht um zeitweilige Praxisschließungen, zu denen ärztliche Berufsverbände aufriefen, sondern um eine abgestufte Kampagne zur Information und Aufklärung der Bevölkerung über die Reformpläne der Bundesregierung. Denn ganz offensichtlich war die Nullrunde nur ein erster Schritt zur Umgestaltung des Gesundheitswesens nach planwirtschaftlichen Vorgaben. Die Wahl der Protestmittel traf zwar nicht überall auf Verständnis, aber die Botschaft wurde verstanden: „Populistisch tönt Ulla Schmidt, sie lasse ‚keine Politik auf Kosten der Patienten' zu. Nur eines geht ihr offenbar ab: der Blick für die Prämissen, die eine Berufsausübung nach dem noblen Vorbild des hippokratischen Arztes überhaupt erst möglich machen“, kommentierte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (10.01.2003). Den Beginn der Informationskampagne des Bündnisses markierten Aktionen in vier Städten am 22. Januar 2003. Mehrere tausend Beschäftigte aus Verbänden und Organisationen der Gesundheitsberufe machten auf verschiedenen Kundgebungen und Informationsveranstaltungen in Rostock, Potsdam, Bremen und Stuttgart erfolgreich auf die Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam. Allein in Rostock beteiligten sich rund 2.500 Menschen an einer Demonstration des „Bündnis Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern“ gegen den Ausverkauf des Gesundheitswesens. In Stuttgart kamen mehr als 1.300 Arzthelferinnen, Apotheker, Krankenhausmitarbeiter und Ärzte zu einem zentralen Aktionstag zusammen. In Potsdam folgten dem Aufruf der brandenburgischen Ärzteschaft zu einer Protestkundgebung über 500 Teilnehmer. Und in Bremen diskutierten die Mitglieder des Bremer „Bündnis Gesundheit 2000“ auf dem Marktplatz mit den Bürgern die Probleme des Gesundheitswesens. Die Proteste richteten sich längst nicht mehr gegen die Nullrundenpolitik der Regierung. Im Kreuzfeuer der Kritik standen die Reformpläne der Bundesgesundheitsministerin. „Die Öffentlichkeit soll erfahren, was gesundheitspolitisch gewollt ist“, begründete der Präsident der Bundesärztekammer gegenüber der „Aachener Zeitung“ (11.01.2003) die Informationskampagne der Gesundheitsberufe. Im Koalitionsvertrag sei noch versprochen worden, die Arbeitsbedingungen für Ärzte zu verbessern. „Tatsache aber ist, dass diese Bedingungen unter dem Deckmantel der Qualitätsverbesserung und Wirtschaftlichkeitssteigerung weiter verschlechtert werden. In Wirklichkeit streben wir der Zuteilungsmedizin und Rationierung zu. Aber das wird von der Politik vernebelt“, sagte Hoppe. Wenn die Ministerin nicht einlenke, seien die Aktionen am 22. Januar nur der Auftakt für weitere Proteste gewesen, warnte die Bundesärztekammer. „Wir können noch schärfer sein“, sagte Hoppe im Interview mit der „Berliner Zeitung“ (18.01.2003). Zugleich zeigte er sich gesprächsbereit: „Wir bevorzugen Lösungen am Verhandlungstisch.“ Der Kommentator der „Berliner Zeitung“ empfahl der Bundesgesundheitsministerin daraufhin, die Proteste der Gesundheitsberufe schon im eigenen Interesse ernst zu nehmen: „Denn gegen den Widerstand der Mediziner, Arzthelferinnen, Krankenschwestern, Zahntechniker, Apotheker und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen sind keine tief greifenden Veränderungen möglich.“ Außerordentlicher Deutscher Ärztetag am 18. Februar 2003Es war aber nicht allein der Druck der Straße, der Bundesgesundheitsministerin Schmidt zu neuen Einsichten zwang. In einem 90-minütigen Gespräch hatte Bundeskanzler Schröder ihr bereits am 9. Januar dargelegt, dass es eine „enge Verzahnung“ von „Inhalt und Prozessen“ der geplanten Strukturreform des BMGS und der Vorschläge der Rürup-Kommission geben müsse, wie Regierungssprecher Anda berichtete. „Schröder durchkreuzt Pläne von Gesundheitsministerin Schmidt“ titelte daraufhin die „Frankfurter Rundschau“ (11.01.2003). Zwar kündigte die Ministerin auch danach noch an, 2003 komme ihre Reform der „Leistungsseite“ und schon in wenigen Tagen werde sie die entsprechenden Eckpunkte vorstellen, doch das Heft des Handelns hatte sie nicht mehr allein in der Hand. Das „Handelsblatt“ (14.01.2003) wusste zu berichten, Kommissionschef Rürup habe persönlich mit dem Kanzler „ein höheres Reformtempo“ vereinbart. Bis zum Sommer wolle er „verwertbare Vorschläge vorlegen, die nach seiner Meinung noch in Schmidts Reform einfließen könnten“. Die Eckpunkte ihrer Reform konnte die Ministerin vorerst nicht präsentieren. Bis zu den Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen am 2. Februar 2003 wollte der Kanzler offenkundig größeres Unheil verhindern. Als die Ministerin am 6. Februar, wenige Tage nach den beiden für die SPD sehr schmerzlichen Wahlniederlagen, ihre Eckpunkte der Öffentlichkeit vorstellen durfte, geschah dies im Beisein des Kommissionsvorsitzenden Rürup. Wie nun nicht mehr anders zu erwarten, teilte die Ministerin mit, dass „Ausgabenstrukturreform“ und „Finanzierungsreform“ miteinander verknüpft würden. Die Beratungen der Rürup-Kommission zur Reform des Gesundheitswesens würden bis Mai 2003 zu Ende geführt. Die Ergebnisse der Kommission würden dann noch in das Reformgesetz einfließen. Diese Marschrichtung war bereits zwei Tage vorher im SPD-Präsidium verabredet worden. Sobald die Vorschläge der Kommission zur Finanzierung und die Vorschläge der Ministerin Ulla Schmidt zur Struktur des Gesundheitswesens vorlägen, würde die Union zu Konsensgesprächen noch vor Eintritt in den Gesetzgebungsprozess eingeladen, hieß es in einer Mitteilung des SPD-Präsidiums. Auch die CDU-Vorsitzende Angela Merkel bekräftigte bei der Präsentation der CDU-Reformkommission „Soziale Sicherheit“ unter der Leitung des Alt-Bundespräsidenten Prof. Dr. Roman Herzog die Bereitschaft der Union, mit der Bundesregierung über Reformschritte im Gesundheitswesen zu sprechen. Zunächst müsse aber Schmidt konkrete Vorschläge für eine Gesundheitsreform unterbreiten. Unter diesen Umständen bekam der bereits im Dezember 2002 vom Vorstand der Bundesärztekammer beschlossene Außerordentliche Deutsche Ärztetag am 18. Februar 2003 eine neue Bedeutung. Die Teilnahme der Fraktionschefs der im Bundestag vertretenen Parteien versprach neue Erkenntnisse darüber, wie der weitere Fahrplan der Reform aussehen sollte. Entsprechend groß war auch das Interesse der Medien an dem Ärztetag. Das zeigte sich bereits in der Vorberichterstattung der Nachrichtenagenturen und Tageszeitungen. In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ (15.02.2003) erneuerte BÄK-Präsident Hoppe seine Kritik an den staatsmedizinischen Vorstellungen des BMGS, wie sie in den Eckpunkten zum Ausdruck kamen. „Die Vorstellung, dass ein nationales Institut Vorgaben macht, die in das medizinische Geschehen eingreifen, dass ein solches Institut Leitlinien bestimmt, an die sich Ärztinnen und Ärzte halten müssen – das ist dem deutschen Gesundheitswesen bislang fremd. Die Patienten haben Ansprüche und dürfen nicht nur etwas zugeteilt bekommen. Dazu möchten wir uns als Ärzte nicht hergeben“, so Hoppe. Die Grundphilosophie der Ministerin stimme einfach nicht:„Zu viel Entrechtung, zu viel Bevormundung“. Zugleich signalisierte Hoppe Zustimmung zu einzelnen Reformmaßnahmen. Auch an der Bereitschaft zu einem konstruktiven Dialog mit der rot-grünen Koalition ließ er keinen Zweifel. Im Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“ (17.02.2003) trat er dem Eindruck entgegen, die Ärzte seien nur Neinsager. „Ganz im Gegenteil. Wir werden zustimmen, wenn die hausärztliche Versorgung verbessert wird. Wir wollen die Facharzt Versorgung in der Breite erhalten, möchten aber dass man hochspezialisierte Tätigkeiten zu den Kliniken hin organisiert. Wir möchten auch mehr Transparenz. Patentenquittungen haben ja vielleicht eine gewisse Verhaltensänderung bei den Versicherten zur Folge“, sagte Hoppe. Der Ärztetag diene dazu, Politik und Öffentlichkeit mit den Reformvorstellungen der Ärzteschaft zu konfrontieren. Dies kam auch in weiteren Interviews, unter anderem mit dem Deutschlandradio Berlin, dem Westdeutschen Rundfunk und dem „Inforadio“ des Senders Freies Berlin und in den Pressemitteilungen des Ärztetages zum Ausdruck. Die Einladung zur Diskussion mit dem Ärztetag schlug Bundesgesundheitsministerin Schmidt allerdings aus. Die Bundesärztekammer nahm die kurzfristige Absage mit Bedauern zur Kenntnis. „Damit ist eine Chance vertan worden, einen offenen Dialog zu führen“, sagte BÄK-Präsident Hoppe gegenüber der „Berliner Zeitung“ (18.02.2003). Auf dem Ärztetag wurde allerdings deutlich sichtbar, dass die Koalitionsfraktionen solche Gespräche für sinnvoll und notwendig erachteten. SPD-Fraktionschef Franz Müntefering bot der Bundesärztekammer gleich zu Beginn seiner Ausführungen vor den 250 Delegierten des Außerordentlichen Deutschen Ärztetages Gespräche an: „Ich glaube, dass wir gemeinsam viele Dinge voranbringen können“, sagte er. Die Eckpunkte des Ministeriums seien nur ein Beitrag zur Entscheidungsfindung und ein Teil des Meinungsbildes, stellte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion ganz unverblümt fest. Damit sei er „auf Distanz zu den Reform-Eckpunkten von Gesundheitsministerin Schmidt“ gegangen, stellte der Korrespondent der „Frankfurter Rundschau“ (19.02.2003) nicht ohne Verblüffung fest. Die Ärzteschaft begrüßte die Gesprächsangebote von Müntefering und der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Krista Sager, fand sich aber vor allem durch die Statements der CDU-Fraktionsvorsitzenden Merkel und des FDP-Fraktionsvorsitzenden Gerhardt in vielen ihrer Positionen bestätigt. „Wir wollen uns aktiv am Reformprozess beteiligen“, sagte BÄK-Präsident Hoppe. An seiner Kritik der BMGS-Reformpläne machte er aber keine Abstriche: Die Vorstellungen des Gesundheitsministeriums seien „eine Anleitung zum Aufbau einer staatsmedizinischen Bürokratie, wie wir sie bisher nicht gekannt haben“, sagte er in seiner Rede, für die er – wie viele Korrespondenten vermerkten – „stehende Ovationen“ des Ärztetages erhielt. „Ärzte greifen Schmidts Gesundheitspläne scharf an“, titelte am Tag danach die Tageszeitung „Die Welt“, „Auch Koalitionspartner auf Distanz zu Schmidt“ meldete die „Süddeutsche Zeitung“ und das „Handelsblatt“ resümierte: „Ulla Schmidt steht im Abseits“. Für den Kommentator der „Süddeutschen Zeitung“ stand nach dem Ärztetag fest, dass die Ministerin „nicht mehr Herrin der Reform, sondern bestenfalls Stichwortgeberin“ sei. „Andere schreiben die Inhalte: die Rürup-Kommission, die SPD-Fraktion, das Kanzleramt und vor allem die Union über ihre Mehrheit im Bundesrat“, hieß es in der „SZ“. Mit ihrem auf dem Ärztetag verabschiedeten Reformprogramm bekräftigte die Ärzteschaft ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an einer Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, die auch in Zukunft eine individuelle Gesundheitsversorgung für alle ermöglicht. „Wir müssen die Stellschrauben des Systems auf mehr Freiheit drehen. Was wir nicht brauchen sind staatliche Bevormundung, außenstehende Experten und Krankenkassenkommissare in der Medizin“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer in seiner viel beachteten Rede. Bei der anstehenden Reform müsse es wieder um Patientenbehandlung und nicht um Krankheitsverwaltung gehen. „Wir brauchen endlich vernünftige Arbeitsbedingungen, unter denen gute Medizin wieder möglich wird“, sagte Hoppe. Vor allem sei eine Reform nötig, die dem Versorgungsbedarf des Patienten gerecht werde. „Wir können bei derart begrenzten Ressourcen nicht länger für die unbegrenzten Leistungsversprechen der Politiker einstehen. Und wir können und wollen auch nicht länger diese Lebenslüge der gesetzlichen Krankenversicherung durch unser Engagement kompensieren“, betonte Hoppe. „Wir haben Vorschläge, die es lohnt zu diskutieren – weil sie ehrlich sind und uns in der Sache weiterbringen.“ Die Ärzteschaft forderte die Politik entschieden auf, die Behandlung der Patienten nach medizinischen Notwendigkeiten auszurichten und nicht nach ökonomischen Vorgaben. Ausschlaggebend für eine gute Versorgung der Patienten seien eine individuelle Behandlung entsprechend dem medizinischen Fortschritt, freie Arztwahl und eine gerechte Verteilung der Mittel für die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Medienresonanz auf den Ärztetag übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. Auf allen Kanälen und in allen Tageszeitungen wurde über den Sonderärztetag berichtet. Schon die umfangreiche Vorberichterstattung ließ erkennen, dass Zeitpunkt und Ort der Versammlung außerordentlich gut gewählt waren. Weit über hundert Journalisten hatten eine Akkreditierung erhalten und berichteten vom Ort des Geschehens im Axica Tagungszentrum direkt am Brandenburger Tor. Elf Kamerateams drängten sich im Tagungssaal, darunter die Berichterstatter der ARD-Tagesschau“, von ZDF-“heute“ sowie von RTL und SAT.1/Pro Sieben. Der Dokumentationskanal Phoenix übertrug die ersten zweieinhalb Stunden der Veranstaltung in voller Länge. Vor und nach der Pressekonferenz in der Mittagspause gab der Präsident der Bundesärztekammer drei Nachrichtensendungen Interviews und auch die Hörfunk-Korrespondentin des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg konnte noch während der Veranstaltung ihre Sammelberichterstattung für die ARD-Rundfunkanstalten mit einem aktuellen Interview ergänzen, in dem BÄK-Präsident Hoppe eine erste persönliche Bewertung der Statements und Diskussionen auf dem Ärztetag vornahm.
Die Ärzteschaft widmete sich im Berichtszeitraum aber nicht nur den viel diskutierten Fragen der Gesundheitspolitik. Auch bei einer Vielzahl von medizinischen Themen war die Pressestelle um die Vermittlung kompetenter Gesprächspartner für die Medien bemüht. Einen Schwerpunkt in der Berichterstattung bildete die Krankheitsprävention, wobei dem Thema Rauchen eine besondere Bedeutung zukam, weil hier auch Verbindungslinien zur Gesundheitspolitik bestanden. So kritisierte die Bundesärztekammer wiederholt die Blockadehaltung der Bundesregierung in der Frage eines EU-weiten Werbeverbots für Tabakwaren. Auch die Forderung des Ärztepräsidenten nach einem Gesundheitszuschlag auf Tabakwaren und Spirituosen fand zum Jahreswechsel 2002/2003 ein großes Echo in den Medien. Die Ärzteschaft beließ es aber nicht allein bei Forderungen an die Politik. Unter dem Motto Gesund – mitten im Leben veranstalteten die Ärztekammern und Kassenärztliche Vereinigungen Ende Oktober 2002 zum dritten Mal „Ärztliche Präventionstage“. Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten und insgesamt 50 Veranstaltungen machten die ärztlichen Körperschaften deutlich, wie Krankheiten frühzeitig erkannt und Risikofaktoren positiv beeinflusst werden können. Durch die Aktionen zu den Themen Bewegung und Sport,Stressbewältigung,Raucherberatung,Impfberatung,Krankheitsfrüherkennung wurde der Öffentlichkeit vermittelt, dass Ärzte nicht nur kompetente Ansprechpartner bei Erkrankungen, sondern auch in Fragen der Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung sind. Besondere Zielgruppe der Präventionstage waren Menschen im mittleren Erwachsenenalter, also solche, die in der Mitte des Lebens stehen, durch Beruf und Familie bestens ausgelastet, aber auch erhöhten gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Die Palette der Themen reichte dabei von Bewegung und Sport, über Stressbewältigung und Raucherberatung bis hin zu Impfberatung und Krankheitsfrüherkennung. Einen Tag vor dem Start der Präventionstage lud die Bundesärztekammer am 28. Oktober 2002 gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu einer Pressekonferenz ein, auf der die Ziele und Themen der Aktion erläutert wurden. In ihrem Statement vor den Journalisten in Berlin hob die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer und Präsidentin der Ärztekammer Bremen, Frau Dr. Ursula Auerswald, die politische Bedeutung der Prävention bei der anstehenden Reform des Gesundheitswesens hervor. Alle Parteien räumten Prävention und Gesundheitsförderung einen hohen Stellenwert ein und sprachen sich für eine Stärkung solcher Maßnahmen aus, konstatierte Auerswald. Fast habe es den Anschein, als sei Prävention zum Zauberwort geworden, mit dem sich gleich mehrere Probleme auf einmal lösen ließen. „Es wird der Eindruck erweckt, mit Prävention könnten Milliardensummen im Gesundheitswesen eingespart werden. Das ist freilich ein Trugschluss. Bevor durch wirksame Krankheitsvorsorge größere Einsparungen erzielt werden können, muss erst einmal die Finanzierung solcher Maßnahmen gesichert werden“, sagte Auerswald. Denn jede Aufklärungskampagne, die breite Bevölkerungsschichten erreichen soll, erfordere massive Anschubfinanzierungen. Und auch die spezifisch ärztlichen Beratungsleistungen bedürften einer angemessenen Vergütung. Es werde deutlich, dass Prävention nicht zur 4. Säule des Gesundheitswesens ausgebaut werden könne, wenn es am finanziellen Fundament fehle. Die von der Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung angekündigte Stärkung der Prävention begrüßte die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer ausdrücklich. Damit würden langjährige Forderungen der Ärzteschaft aufgegriffen, Prävention und Eigenvorsorge zu stärken. „Die Menschen müssen verstehen, dass sich gesundheitsbewusstes Verhalten auszahlt – für sie persönlich und für die Versichertengemeinschaft insgesamt“, so Auerswald. Auch müsse die Frage erlaubt sein, wie eine nationale Kampagne zur Reduktion des Tabakkonsums wirksam sein könne, wenn sie nicht die Durchsetzung eines umfassenden Tabakwerbeverbots mit einbeziehe. Anstatt aber dem britischen Vorbild zu folgen und Zigarettenwerbung zu verbieten, blockiere Deutschland als einziges EU-Mitgliedsland ein europaweites Werbeverbot für Tabakwaren. „Die Politik der Bundesregierung auf diesem Gebiet verstehe wer will, ich verstehe sie nicht. Die Anti-Tabak-Kampagne kann nicht erfolgreich sein, wenn junge Menschen an jeder Straßenecke mit zielgruppengerechter Werbung zum Rauchen verführt werden“, betonte Auerswald. Auch die Bedeutung eines umfassenden Impfschutzes hob die Bundesärztekammer in der Pressekonferenz hervor. „Gerade im Erwachsenenalter wird dieser höchst wirksame Schutz vor schwersten Infektionskrankheiten sehr vernachlässigt. Die Impfbereitschaft in Deutschland ist nach wie vor zu gering. Das betrifft sowohl Auffrischungsimpfungen wie auch Reise-Impfungen, die ja in unserem hochmobilen Zeitalter eine ganz wichtige Rolle spielen“, so Dr. Ulrich Oesingmann, stellvertrender Vorsitzender des Ausschusses „Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation“ der Bundesärztekammer. Fortbildung in der Medizin: Fortschritte und RückschritteWährend sich das Thema Prävention kaum zur parteipolitischen Profilierung eignete, war die Fortbildung von Ärzten immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Mal waren es die Krankenkassen, die einen „Ärzte-TÜV“ ins Gespräch brachten, mal Politiker und Berater der Regierungskoalition. Kurz nach der Bundestagswahl am 22. September 2002 sprach sich erneut Bundesgesundheitsministerin Schmidt für eine Zwangsüberprüfung der regelmäßigen Fortbildung von Ärzten aus. Die Bundesärztekammer bezeichnete diese Idee einer Rezertifizierung als „völlig unsinnig und realitätsfremd“. Berufsbegleitende Fortbildung sei längst verpflichtender Bestandteil der ärztlichen Berufsordnung, sagte Prof. Dr. Heyo Eckel, Vorsitzender des Deutschen Senats für ärztliche Fortbildung und Präsident der Ärztekammer Niedersachsen. Seit Einführung des Fortbildungszertifikats der Ärztekammern im Jahr 1999 könnten die Ärzte ihre Fortbildungsaktivitäten auch nachweisen und gegenüber den Patenten dokumentieren. „Ein solches Verfahren ist transparenter und sicher auch motivierender als die Drohung mit ‚Strafen'. Letztlich entscheiden die Patienten darüber, welchem Arzt sie vertrauen“, so Eckel. In einem Presse-Hintergrundgespräch betonte die Bundesärztekammer, dass es eine rigorose Rezertifizierung mit dem drohenden Verlust der Arztzulassung nur in Slowenien und Kroatien gebe. In anderen europäischen Ländern und in Nordamerika gebe es verschiedene Modelle der Zertifizierung von Fortbildung, aber keinen „Ärzte-TÜV“. Im Vordergrund stehe auch in diesen Ländern die Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur Fortbildung der Ärzte. Rezertifizierungen nach slowenischem oder kroatischem Muster würden als Rückschritt betrachtet. Die Bundesärztekammer wies auf die hohe Zahl der Teilnehmer an den zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammern hin und hob ihren eigenen großen Fortbildungskongress hervor, das Interdisziplinäre Forum „Fortschritt und Fortbildung in der Medizin“. Auch in den Medien traf das 27. Interdisziplinäre Forum der Bundesärztekammer im Januar 2003 auf ein bemerkenswertes Echo. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Denn der Standort Köln bot für die Pressearbeit zum Forum keine allzu guten Voraussetzungen. Das Interesse an dem Kongress als solchen ist zwar ungebrochen, den Aufwand einer Anreise nach Köln scheuen viele Fach- und Wissenschaftsjournalisten aber zunehmend. Deshalb war es auch eine glückliche Fügung, dass die Wissenschafts- Pressekonferenz e.V. eine Anfrage der Pressestelle positiv beschied und ihr Interesse an einer Pressekonferenz zum Forum bekundete. Auf Einladung des renommierten Vereins von Medizin- und Wissenschaftsjournalisten fand die traditionelle Pressekonferenz zum Forum daher zum ersten Mal „auswärts“ statt, am 9. Januar im Wissenschaftszentrum Bonn. Die Pressekonferenz mit den Referenten des Forums stieß auf großes Interesse und wurde sogar live im Internet übertragen. Im Anschluss an die Pressekonferenz bot sich in Interviews mit dem Deutschlandfunk und dem Saarländischen Rundfunk Gelegenheit, einem breiten Publikum die Ziele und Themenschwerpunkte des Forums zu erläutern. Auch mit anderen Hörfunksendern wie dem WDR und dem SWR konnten während der Tagung Interviews vermittelt werden. Darüber hinaus gab der Vorsitzende des Deutschen Senats für ärztliche Fortbildung, Prof. Dr. Heyo Eckel, der „Süddeutschen Zeitung“ (14.01.2003) ein ausführliches Interview, in dem er die Bedeutung der medizinischen Forschung für die Arztpraxis erläuterte. Für die in Köln ansässige lokale Presse fand ein weiteres Pressegespräch statt, sodass alle interessierten Medien umfassend informiert werden konnten. Hervorzuheben ist die fundierte Berichterstattung der Fach- und Wissenschaftsjournalisten, wie z.B. der Ärzte Zeitung. Aber auch in Berichten der Nachrichtenagenturen und in verschiedenen Tageszeitungen fanden die Themen des Forums ihren Niederschlag, insbesondere das Thema Botulinum – vom giftigsten aller Gifte zum segensreichen Medikament? Die Berichte über den Missbrauch von Botulinumtoxin ('Botox') als Lifestyle-Medikament zum Körperdesign verliehen diesem Thema besondere Aktualität. Die Referenten zeigten jedoch auf, dass Botulinumtoxin auch anderweitig einsetzbar ist und zum Beispiel gute Ergebnisse bei der Behandlung spastischer Bewegungsstörungen zu verzeichnen sind. Auf großes Interesse stieß bei den Medien auch das Thema Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Prof. Dr. Bernhard Blanz von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum der Universität Jena erläuterte, dass zwischen fünf und zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen an solchen Störungen litten und auf den jeweiligen Patienten abgestimmte Behandlungsprogramme unabdingbar seien. Zu der überraschend vielgestaltigen Berichterstattung haben auch die sieben Pressemitteilungen beigetragen, die von der Pressestelle zu den Themen des Forums verbreitet wurden. Ein Teil davon wurde auch als „Tickermeldung“ über den Originaltextservice der dpa-Tochter News Aktuell versendet und erreichte dadurch eine außerordentlich große Breitenwirkung. Das Forum bot den Journalisten zudem einen hervorragenden Überblick über die Mechanismen ärztlicher Fortbildung. Mediziner und Medienvertreter nutzten die Möglichkeit, aktuelle Fragen auch aus den Randbereichen der jeweiligen Fortbildungsthemen zu diskutieren. |
| © 2003, Bundesärztekammer. |